Two articles to read!
18 Beiträge
• Seite 1 von 1
Two articles to read!
Here are two interesting articles, already online but not yet officially published.
The first is about the microgynes of Myrmica rubra as specialized parasites of old host colonies (The article: http://antcat.org/documents/6310/schar_ ... asites.pdf ; the supplemental material you can download here: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1 ... 2/suppinfo ).
The second is a review by P. S. Ward about “The Phylogeny and Evolution of Ants” ( http://antcat.org/documents/6308/ward_2 ... f_ants.pdf ).
Enjoy!
The first is about the microgynes of Myrmica rubra as specialized parasites of old host colonies (The article: http://antcat.org/documents/6310/schar_ ... asites.pdf ; the supplemental material you can download here: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1 ... 2/suppinfo ).
The second is a review by P. S. Ward about “The Phylogeny and Evolution of Ants” ( http://antcat.org/documents/6308/ward_2 ... f_ants.pdf ).
Enjoy!
- 4
Teleutotje
" Tell-oo-toat-yeh "
" I am who I am , I think ... "
" Tell-oo-toat-yeh "
" I am who I am , I think ... "
-

Teleutotje - Mitglied
- Beiträge: 1423
- Registriert: Freitag 1. August 2014, 18:01
- Wohnort: Nazareth, Belgium
- Bewertung: 1253
Re: Two articles to read!
Myrmica rubra Mikrogynen – neue Arbeit:
Evidence that microgynes of Myrmica rubra ants are social parasites that attack old host colonies
S. SCHÄR & D. R. NASH
2014 EUROPEAN SOC IETY FOR EVOLUTIONARY BI OLOGY. J . EVOL. BIOL. d o i : 1 0 . 1 11 1 /j eb . 1 2 482
Keywords: fitness; microrubra; miniature queens; reproductive morph; reproductive success; virulence.
Abstract
Ant microgynes are miniaturized queen forms found together with normal queens (macrogynes) in species occurring across the ant phylogeny. Their role is not yet fully understood: in some cases, they seem to be nonparasitic alternative reproductive morphs, in others incipient social parasites, and thus potential models for studying the evolution of social parasitism. Whether they are regarded as parasitic or not has traditionally been based on genetic differentiation from syntopic macrogynes and/or the queen/worker ratio of their offspring rather than measuring fitness traits. We confirmed previously reported genetic differentiation between microgynes and macrogynes of Myrmica rubra in a population studied for the first time.
Further, we measured virulence and infectivity of M. rubra microgynes in a controlled laboratory experiment. Nests headed only by macrogynes (controls), only by microgynes, and naturally and artificially mixed nests were kept under identical conditions. We found reduction in worker numbers of both naturally and artificially mixed macrogyne/microgyne nests compared with controls, and strong reduction but also surprising variation in fitness of nests headed only by microgynes. Microgyne nests produced workers, males and microgynes. Microgynes did not themselves reproduce in artificially mixed nests, but reproduced most in naturally mixed nests that had lost their macrogyne queen. This, together with higher mortality of field-collected macrogyne queens from naturally infested colonies and greater estimated relative age of macrogyne queens in naturally infected nests, suggests that they preferentially exploit older host colonies. We conclude that M. rubra microgynes are intraspecific social parasites specialized on exploiting old host colonies.
Hier ist die “Geschichte” der ehemaligen Myrmica microrubra verzeichnet:
http://ameisenwiki.de/index.php/Myrmica ... D_M._rubra
Im AP: viewtopic.php?f=48&t=721&p=4869&hilit=microrubra#p4869
Und ein Thread im AF aus 2011/12:
http://www.ameisenforum.de/europ-ische- ... sehen.html
Die neue Arbeit über ein in Dänemark entdecktes Vorkommen von Mikrogynen der Myrmica rubra verspricht im Titel „Evidenz dafür, dass die Mikrogynen Sozialparasiten sind, die alte M. rubra-Kolonien attackieren.
Die Arbeit selbst kommt dann zu dem Schluss, dass es sich dabei um einen „intraspezifischen Sozialparasitismus“ handle.
Nun ist das eine Worthülse ohne klar definierbaren Inhalt. Der Begriff wurde bereits im Zusammenhang mit Temnothorax nylanderi verwendet, wo junge Königinnen alte ersetzen und sich damit die alte Arbeiterschaft zunutze machen können. Aber so etwas kommt bei allen polygynen Arten vor, so weit sie immer mal wieder alte Königinnen durch neue ersetzen.
Was also soll der Begriff? – Es ist keine separate Art. Eher eine Variante der Art Myrmica rubra, die nach den Untersuchungen von Schär & Nash eine gewisse Fitness-Minderung betroffener Kolonien verursacht.
Vielleicht hat die Mikrogynen-Form, falls sie eine genetische Ursache hat, als Ursache so etwas wie die Sichelzellenanämie bei Menschen (http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... edirect=no ), also einen rezessiven, seltenen Gendefekt, der homozygot tödlich sein kann, heterozygot aber unter Umständen sogar einen Selektionsvorteil darstellt (Schutz vor Malaria). Betroffene und hilfsbedürftige Homo sapiens betrachten wir allerdings nicht als „intraspezifische Sozialparasiten“.
Über die Ursachen des sporadischen, lokalen Auftretens der Mikrogynen-Variante weiß man nach wie vor nichts Sicheres.
Auffällig ist, dass man auch in den Ameisenforen, wo ja viel über gekaufte M. rubra-Kolonien berichtet wird, seit Jahren nichts mehr über Funde dieser Form gelesen hat. – Im AF gab es mal einen Hinweis, dem ich damals nachging: Der Thread-Autor und Halter hatte mir beschrieben, wo er die Mikrogynen gefunden hatte; ich fuhr dorthin und konnte auch noch ein paar Exemplare antreffen. Sie fanden in genetischen Untersuchungen zur Identität der Tiere Verwendung.
Leider sind sowohl die Arbeit Schär & Nash als auch das Supplement nicht mehr frei zugänglich. Einige Details der Haltung der gemischten bzw. künstlich infizierten Kolonien hätten mich schon noch interessiert….
MfG,
Merkur
Evidence that microgynes of Myrmica rubra ants are social parasites that attack old host colonies
S. SCHÄR & D. R. NASH
2014 EUROPEAN SOC IETY FOR EVOLUTIONARY BI OLOGY. J . EVOL. BIOL. d o i : 1 0 . 1 11 1 /j eb . 1 2 482
Keywords: fitness; microrubra; miniature queens; reproductive morph; reproductive success; virulence.
Abstract
Ant microgynes are miniaturized queen forms found together with normal queens (macrogynes) in species occurring across the ant phylogeny. Their role is not yet fully understood: in some cases, they seem to be nonparasitic alternative reproductive morphs, in others incipient social parasites, and thus potential models for studying the evolution of social parasitism. Whether they are regarded as parasitic or not has traditionally been based on genetic differentiation from syntopic macrogynes and/or the queen/worker ratio of their offspring rather than measuring fitness traits. We confirmed previously reported genetic differentiation between microgynes and macrogynes of Myrmica rubra in a population studied for the first time.
Further, we measured virulence and infectivity of M. rubra microgynes in a controlled laboratory experiment. Nests headed only by macrogynes (controls), only by microgynes, and naturally and artificially mixed nests were kept under identical conditions. We found reduction in worker numbers of both naturally and artificially mixed macrogyne/microgyne nests compared with controls, and strong reduction but also surprising variation in fitness of nests headed only by microgynes. Microgyne nests produced workers, males and microgynes. Microgynes did not themselves reproduce in artificially mixed nests, but reproduced most in naturally mixed nests that had lost their macrogyne queen. This, together with higher mortality of field-collected macrogyne queens from naturally infested colonies and greater estimated relative age of macrogyne queens in naturally infected nests, suggests that they preferentially exploit older host colonies. We conclude that M. rubra microgynes are intraspecific social parasites specialized on exploiting old host colonies.
Hier ist die “Geschichte” der ehemaligen Myrmica microrubra verzeichnet:
http://ameisenwiki.de/index.php/Myrmica ... D_M._rubra
Im AP: viewtopic.php?f=48&t=721&p=4869&hilit=microrubra#p4869
Und ein Thread im AF aus 2011/12:
http://www.ameisenforum.de/europ-ische- ... sehen.html
Die neue Arbeit über ein in Dänemark entdecktes Vorkommen von Mikrogynen der Myrmica rubra verspricht im Titel „Evidenz dafür, dass die Mikrogynen Sozialparasiten sind, die alte M. rubra-Kolonien attackieren.
Die Arbeit selbst kommt dann zu dem Schluss, dass es sich dabei um einen „intraspezifischen Sozialparasitismus“ handle.
Nun ist das eine Worthülse ohne klar definierbaren Inhalt. Der Begriff wurde bereits im Zusammenhang mit Temnothorax nylanderi verwendet, wo junge Königinnen alte ersetzen und sich damit die alte Arbeiterschaft zunutze machen können. Aber so etwas kommt bei allen polygynen Arten vor, so weit sie immer mal wieder alte Königinnen durch neue ersetzen.
Was also soll der Begriff? – Es ist keine separate Art. Eher eine Variante der Art Myrmica rubra, die nach den Untersuchungen von Schär & Nash eine gewisse Fitness-Minderung betroffener Kolonien verursacht.
Vielleicht hat die Mikrogynen-Form, falls sie eine genetische Ursache hat, als Ursache so etwas wie die Sichelzellenanämie bei Menschen (http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... edirect=no ), also einen rezessiven, seltenen Gendefekt, der homozygot tödlich sein kann, heterozygot aber unter Umständen sogar einen Selektionsvorteil darstellt (Schutz vor Malaria). Betroffene und hilfsbedürftige Homo sapiens betrachten wir allerdings nicht als „intraspezifische Sozialparasiten“.
Über die Ursachen des sporadischen, lokalen Auftretens der Mikrogynen-Variante weiß man nach wie vor nichts Sicheres.
Auffällig ist, dass man auch in den Ameisenforen, wo ja viel über gekaufte M. rubra-Kolonien berichtet wird, seit Jahren nichts mehr über Funde dieser Form gelesen hat. – Im AF gab es mal einen Hinweis, dem ich damals nachging: Der Thread-Autor und Halter hatte mir beschrieben, wo er die Mikrogynen gefunden hatte; ich fuhr dorthin und konnte auch noch ein paar Exemplare antreffen. Sie fanden in genetischen Untersuchungen zur Identität der Tiere Verwendung.
Leider sind sowohl die Arbeit Schär & Nash als auch das Supplement nicht mehr frei zugänglich. Einige Details der Haltung der gemischten bzw. künstlich infizierten Kolonien hätten mich schon noch interessiert….
MfG,
Merkur
- 5
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Two articles to read!
Hallo Merkur,
vielen Dank für die Ausführungen zu dem Thema.
Das mit den Worthülsen im Zusammenhang mit intraspezifischen Problemen ist ja auch an anderer Stelle leider ein Problem und wird dort kritisiert. Schade, dass die Arbeiten da nicht frei verfügbar sind, um der Begrifflichkeit näher auf den Grund zu gehen.
Was kam denn dabei raus? "Ganz normale" M. rubra?
vielen Dank für die Ausführungen zu dem Thema.
Merkur hat geschrieben:
Die neue Arbeit über ein in Dänemark entdecktes Vorkommen von Mikrogynen der Myrmica rubra verspricht im Titel „Evidenz dafür, dass die Mikrogynen Sozialparasiten sind, die alte M. rubra-Kolonien attackieren.
Die Arbeit selbst kommt dann zu dem Schluss, dass es sich dabei um einen „intraspezifischen Sozialparasitismus“ handle.
Nun ist das eine Worthülse ohne klar definierbaren Inhalt.
Das mit den Worthülsen im Zusammenhang mit intraspezifischen Problemen ist ja auch an anderer Stelle leider ein Problem und wird dort kritisiert. Schade, dass die Arbeiten da nicht frei verfügbar sind, um der Begrifflichkeit näher auf den Grund zu gehen.
Sie fanden in genetischen Untersuchungen zur Identität der Tiere Verwendung.
Was kam denn dabei raus? "Ganz normale" M. rubra?
- 0
- Colophonius
Re: Two articles to read!
Hoi,
die intraspezifische Homogenisierung ist eine These, die unter anderem in "Ecological and evolutionary consequences of biotic homogenization" - Julian D. Oldenemail, N. LeRoy Poff, Marlis R. Douglas, Michael E. Douglas, Kurt D. Fausch, TiE&E Volume 19, Issue 1, p18–24, January 2004, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2003.09.010 abgehandelt wird.
Es handelt sich dabei mitnichten um eine Worthülse, auch wenn das zwei, drei gerne, laut und ständig behaupten - und es ist bei Weitem nicht auf Ameisen beschränkt, was ebenfalls nicht von den Personen erwähnt wird. Weiterhin können problemlos die Autoren um ein Exemplar gebeten werden - der Erstautor ist in der Regel die beste Anlaufstelle. Ebenfalls kann über Bibliotheken Zugang erlangt werden. Grund hierfür ist die Tatsache, dass Forschung nur dann frei ist, wenn sie staatlich finanziert ist - und nicht über ein Privatunternehmen publiziert wird; diese wollen Profit erreichen, bieten aber z.B. ein Peer Review mit allen seinen Stärken und Schwächen. Andere Vorgehensweisen gibt es ebenfalls, siehe z.B. Alternativprogramm pubmed.org .
@ Colophonius: Hast Du ihn schon angeschrieben? Hat dir Herr Seifert geantwortet?
die intraspezifische Homogenisierung ist eine These, die unter anderem in "Ecological and evolutionary consequences of biotic homogenization" - Julian D. Oldenemail, N. LeRoy Poff, Marlis R. Douglas, Michael E. Douglas, Kurt D. Fausch, TiE&E Volume 19, Issue 1, p18–24, January 2004, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2003.09.010 abgehandelt wird.
Es handelt sich dabei mitnichten um eine Worthülse, auch wenn das zwei, drei gerne, laut und ständig behaupten - und es ist bei Weitem nicht auf Ameisen beschränkt, was ebenfalls nicht von den Personen erwähnt wird. Weiterhin können problemlos die Autoren um ein Exemplar gebeten werden - der Erstautor ist in der Regel die beste Anlaufstelle. Ebenfalls kann über Bibliotheken Zugang erlangt werden. Grund hierfür ist die Tatsache, dass Forschung nur dann frei ist, wenn sie staatlich finanziert ist - und nicht über ein Privatunternehmen publiziert wird; diese wollen Profit erreichen, bieten aber z.B. ein Peer Review mit allen seinen Stärken und Schwächen. Andere Vorgehensweisen gibt es ebenfalls, siehe z.B. Alternativprogramm pubmed.org .
@ Colophonius: Hast Du ihn schon angeschrieben? Hat dir Herr Seifert geantwortet?
- 4
Wissen ist Macht und Macht ist Kraft und Kraft ist Energie und Energie ist Materie und Materie ist Masse und deshalb krümmen große Ansammlungen von Wissen Raum und Zeit (Die Gelehrten der Scheibenwelt - Pratchett/Stewart/Cohen)
-
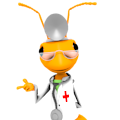
NIPIAN - Administrator
- Beiträge: 281
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 10:43
- Bewertung: 599
Re: Two articles to read!
NIPIAN hat geschrieben:Hoi,
die intraspezifische Homogenisierung ist eine These, die unter anderem in "Ecological and evolutionary consequences of biotic homogenization" - Julian D. Oldenemail, N. LeRoy Poff, Marlis R. Douglas, Michael E. Douglas, Kurt D. Fausch, TiE&E Volume 19, Issue 1, p18–24, January 2004, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2003.09.010 abgehandelt wird.
Es handelt sich dabei mitnichten um eine Worthülse, auch wenn das zwei, drei gerne, laut und ständig behaupten - und es ist bei Weitem nicht auf Ameisen beschränkt, was ebenfalls nicht von den Personen erwähnt wird. Weiterhin können problemlos die Autoren um ein Exemplar gebeten werden - der Erstautor ist in der Regel die beste Anlaufstelle. Ebenfalls kann über Bibliotheken Zugang erlangt werden. Grund hierfür ist die Tatsache, dass Forschung nur dann frei ist, wenn sie staatlich finanziert ist - und nicht über ein Privatunternehmen publiziert wird; diese wollen Profit erreichen, bieten aber z.B. ein Peer Review mit allen seinen Stärken und Schwächen. Andere Vorgehensweisen gibt es ebenfalls, siehe z.B. Alternativprogramm pubmed.org .
Schade dass du dich so auf die intraspezifische Homogenisierung versteifst, obwohl es mir hier gar nicht darum ging. Meine Frage bezog sich völllig auf den intraspezifischen Sozialparasitismus und
auf diese Frage.Leider sind sowohl die Arbeit Schär & Nash als auch das Supplement nicht mehr frei zugänglich.
Statt deiner Aussagen über die intraspezifische Homogenisierung, hätte ich mir ehrlich gesagt irgendwas zum Thema gewünscht. Vor allem das Ergebnis dieser Untersuchung ist sicherlich spannend.
Auffällig ist, dass man auch in den Ameisenforen, wo ja viel über gekaufte M. rubra-Kolonien berichtet wird, seit Jahren nichts mehr über Funde dieser Form gelesen hat. – Im AF gab es mal einen Hinweis, dem ich damals nachging: Der Thread-Autor und Halter hatte mir beschrieben, wo er die Mikrogynen gefunden hatte; ich fuhr dorthin und konnte auch noch ein paar Exemplare antreffen. Sie fanden in genetischen Untersuchungen zur Identität der Tiere Verwendung.
Aber naja, Ausführungen zur intraspezifischen Homogenisierung sind ja auch was tolles und nie dagewesenes.
@ Colophonius: Hast Du ihn schon angeschrieben? Hat dir Herr Seifert geantwortet?
Was hat das jetzt mit der Sache zu tun?
- 0
- Colophonius
Re: Two articles to read!
Ach Colophonius, es fällt mir schwer dir zu glauben. Das hängt unter anderem mit deinem destruktiven Verhalten zusammen, das du nur hier in Forum an den Tag legst, während du in andern Foren ganz moderat auftrittst. So habe auch ich deine Frage als erneute "Stichelei" interpretiert und gestern bereits eine Antwort verfasst, die ich bisher aber doch nicht veröffentlicht habe. Aber seis drum:
Könntest du vielleicht noch auf die andere Stelle verweisen, bzw. zeigen wo die Worthülse des "intraspezifischen Sozialparasitismus" noch zum "Problem" und kritisiert wird?
undMeine Frage bezog sich völllig auf den intraspezifischen Sozialparasitismus
Das mit den Worthülsen im Zusammenhang mit intraspezifischen Problemen ist ja auch an anderer Stelle leider ein Problem und wird dort kritisiert.
Könntest du vielleicht noch auf die andere Stelle verweisen, bzw. zeigen wo die Worthülse des "intraspezifischen Sozialparasitismus" noch zum "Problem" und kritisiert wird?
- 1
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
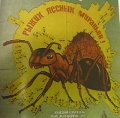
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
Re: Two articles to read!
Die end- und fruchtlosen Diskussionen zur „interspezifischen Homogenisierung“ kennst du ja als User verschiedener Foren selbst. Dort wird es zu einem kritisierten „Problem“, dass intraspezifische Homogenisierung oft nur als abstrakte Gefahr oder als Worthülse gesehen wird. Aber da wir (mal wieder) beim Thema sind: In der von NIPIAN angegebenen Quelle ist übrigens immer nur von der intraspezifischen Hybridisierung und der genetischen Homogenisierung die Rede (hier im Ganzen nachzulesen, durchaus spanned!). Mir schleierhaft, dass unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet werden, aber das gleiche gemeint sein soll.
Der Rest meines Textes bezog sich wirklich auf den „intraspezifischen Sozialparasitismus“, der mich auch wirklich interessiert.
Destruktiv finde ich die Arbeit mit vorwarnungslosen Banns und mit (neudeutsch:)"Downvotes".
Der Rest meines Textes bezog sich wirklich auf den „intraspezifischen Sozialparasitismus“, der mich auch wirklich interessiert.
Ach Colophonius, es fällt mir schwer dir zu glauben. Das hängt unter anderem mit deinem destruktiven Verhalten zusammen, dass du nur hier in Forum an den Tag legst,
Destruktiv finde ich die Arbeit mit vorwarnungslosen Banns und mit (neudeutsch:)"Downvotes".
- 0
- Colophonius
Re: Two articles to read!
Hoi,
intraspezifischer Sozialparasitismus ist ursprünglich in Bienenvölkern proklamiert worden. Siehe Intraspecific queen parasitism in a highly eusocial bee - Tom Wenseleers, Denise A. Alves, Tiago M. Francoy, Johan Billen and Vera L. Imperatriz-Fonseca, doi: 10.1098/rsbl.2010.0819. Die Frage ist also, in wie fern hier eine Parallele gezogen werden kann.
Genetic homogenization ist das, was intraspezifische Homogenisierung im Deutschen meint.
Das bedeutet wiederum: Colophonius, Du versuchst an dieser Stelle ein Problem zu produzieren, an der keines zu finden ist. Intraspezifische Homogenisierung existiert, im Englischen als genetic homogenization bezeichnet. Die Definition beider Begriffe ist dieselbe. Very easy, I think. Wenn Du das widerlegen willst, wende dich mit deiner Ausarbeitung an Herrn Olden und die anderen Autoren (Stockwell, Storfer etc.). Bis Du das geschafft hast, wird einfach davon ausgegangen, dass genetic homogenization, resp. intraspezifische Homogenisierung, ein Teil der Biologie ist, die man in einigen Situationen zu beachten hat.
Das Nette ist, wo "Downvotes", da "Upvotes". Zur "Bringschuld" von Wissenschaftlern gibt es die "Holschuld" von Nicht-Wissenschaftlern. Ergo: ab einem gewissen Punkt müssen sich die Wege von Menschen trennen. Vor allem dann, wenn es nur um destruktives Verhalten in fremden Häusern geht.
intraspezifischer Sozialparasitismus ist ursprünglich in Bienenvölkern proklamiert worden. Siehe Intraspecific queen parasitism in a highly eusocial bee - Tom Wenseleers, Denise A. Alves, Tiago M. Francoy, Johan Billen and Vera L. Imperatriz-Fonseca, doi: 10.1098/rsbl.2010.0819. Die Frage ist also, in wie fern hier eine Parallele gezogen werden kann.
Genetic homogenization ist das, was intraspezifische Homogenisierung im Deutschen meint.
Die Beschreibung "genetische Homogenisierung" trifft es wörtlich übersetzt zwar besser, die Wortwahl "intraspezifisch" zeigt allerdings, dass es innerhalb der Art/Spezies stattfindet. Und exakt das steht unter der Erklärung "genetic homogenization".Genetic homogenization reduces the spatial component of genetic variability within a species or among populations of a species (Box 1). It can occur through a variety of mechanisms: (i) intentional translocation of populations from one part of the range to another; (ii) intentional introductions of species outside of their normal ranges; and (iii) extirpation of local or regional faunas. Genetic homogenization is a serious but often less recognized threat to the integrity of endemic gene pools, and can have several important implications.
Das bedeutet wiederum: Colophonius, Du versuchst an dieser Stelle ein Problem zu produzieren, an der keines zu finden ist. Intraspezifische Homogenisierung existiert, im Englischen als genetic homogenization bezeichnet. Die Definition beider Begriffe ist dieselbe. Very easy, I think. Wenn Du das widerlegen willst, wende dich mit deiner Ausarbeitung an Herrn Olden und die anderen Autoren (Stockwell, Storfer etc.). Bis Du das geschafft hast, wird einfach davon ausgegangen, dass genetic homogenization, resp. intraspezifische Homogenisierung, ein Teil der Biologie ist, die man in einigen Situationen zu beachten hat.
Das Nette ist, wo "Downvotes", da "Upvotes". Zur "Bringschuld" von Wissenschaftlern gibt es die "Holschuld" von Nicht-Wissenschaftlern. Ergo: ab einem gewissen Punkt müssen sich die Wege von Menschen trennen. Vor allem dann, wenn es nur um destruktives Verhalten in fremden Häusern geht.
- 4
Wissen ist Macht und Macht ist Kraft und Kraft ist Energie und Energie ist Materie und Materie ist Masse und deshalb krümmen große Ansammlungen von Wissen Raum und Zeit (Die Gelehrten der Scheibenwelt - Pratchett/Stewart/Cohen)
-
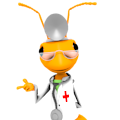
NIPIAN - Administrator
- Beiträge: 281
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 10:43
- Bewertung: 599
Re: Two articles to read!
Back to Topic.
Irgendwie ist es trotzdem aber ganz schön komisch, in einem ohnehin polygynen Volk von Sozialparasitismus zu sprechen, nur weil einige der Gynen kleiner sind als die andern. Ich hab ja eher zufällig Anfang des Jahres eine Myrmica-Gyne gefunden, die ich auf den ersten Blick nur für eine Arbeiterin gehalten habe. Als ich den kräftigeren Thorax bemerkte, hab ich sie auch erst für die Gyne einer kleineren Art gehalten.
Die Frage, die sich mir in dem Zusammenhang stellt ist, ob die Microgynen auch selbständig gründen oder ob sie evtl ein anderes Nest suchen, in das sie "eindringen" können. Die Jahreszeit dafür (April) hätte ja auch gut gepasst. Die bereits überwinterten Völker haben noch wenige Arbeiterinnen, die Aktivität ist noch nicht so hoch.
Es handelt sich übrigens um dier hier
Irgendwie ist es trotzdem aber ganz schön komisch, in einem ohnehin polygynen Volk von Sozialparasitismus zu sprechen, nur weil einige der Gynen kleiner sind als die andern. Ich hab ja eher zufällig Anfang des Jahres eine Myrmica-Gyne gefunden, die ich auf den ersten Blick nur für eine Arbeiterin gehalten habe. Als ich den kräftigeren Thorax bemerkte, hab ich sie auch erst für die Gyne einer kleineren Art gehalten.
Die Frage, die sich mir in dem Zusammenhang stellt ist, ob die Microgynen auch selbständig gründen oder ob sie evtl ein anderes Nest suchen, in das sie "eindringen" können. Die Jahreszeit dafür (April) hätte ja auch gut gepasst. Die bereits überwinterten Völker haben noch wenige Arbeiterinnen, die Aktivität ist noch nicht so hoch.
Es handelt sich übrigens um dier hier
- 1
-

Trailandstreet - Mitglied
- Beiträge: 1174
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 21:02
- Wohnort: Ho'mbua
- Bewertung: 1693
Re: Two articles to read!
Der von NIPIAN zitierte Artikel von Wenseleers et al. über „Intraspezifischen Königinnenparasitismus“ bei einer Meliponine (Stachellose Bienen) wurde im Oktober 2010 online publiziert.
Eine der älteren Arbeiten zum Thema, auf die ich mich bezog, ist 10 Jahre früher erschienen:
Foitzik, S., Heinze, J. 2000. Intraspecific parasitism and split sex ratios in a monogynous and monandrous ant. Behavioural Ecology and Sociobiology 47: 424-431. Untersucht wurde das an Temnothorax nylanderi.
Wiederholt habe ich es (auch in Forenbeiträgen) bereits bedauert, dass Fachbegriffe nicht „geschützt“ sind, dass jeder etwas anderes darunter verstehen kann.
„Parasitismus“ ist ein Leben auf Kosten eines Wirtes, und meines Erachtens sollte so etwas auf verschiedene Arten bezogen sein.
Andernfalls wären wir womöglich alle „intraspezifische Parasiten“: Beginnend als Endoparasiten im Uterus, dann als Ektoparasiten Körpersäfte der Mutter nuckelnd, dann unter Einsatz aller Mittel der Eltern im Kindes- und Jugendalter aufgezogen, schließlich als „Sozialparasiten“ von der Rente lebend. Dazwischen liegt eine selbständige Phase im Erwerbsalter, wo viele von uns dann als „Wirte“ das Leben der Jüngeren resp. Älteren alimentieren. Der Begriff „Mutualismus“*) scheint mir persönlich da besser geeignet.
Zu „Intraspez. Homogenisierung“ resp. „genetic homogenization“: Das bedeutet tatsächlich dasselbe.
Der Artikel von Oldenemail et al. 2004 (zitiert hier: viewtopic.php?f=23&t=738&p=5109#p5101 ) erschien in der Zeitschrift TREE („Trends in Ecology and Evolution“) im Januar 2004.
In demselben Jahr 2004 erschien mein Artikel „International Pet Ant Trade Increasing Risk and Danger in Europe – (Hymenoptera, Formicidae).” - Aliens 19&20, 24-26, sowie die deutsche Fassung in Myrmecological News, in der der deutsche Begriff „Intraspezifische Homogenisierung“ eingeführt wurde.
Die Autoren des TREE-Artikels konnten von meinen beiden Artikeln nichts wissen, und da diese auch eingereicht worden sind, bevor ich von dem TREE-Artikel Kenntnis bekam, konnte auch nicht kreuzweise zitiert werden. Auch die Referees haben mich nicht auf die Existenz des TREE-Beitrags hingewiesen. - So etwas ist in der wiss. Literatur halt Alltag.
Nicht vergessen darf man, dass der „Intraspezifischen Homogenisierung“ eine „intraspezifische Faunenverfälschung“ vorangeht (so hatte ich das ursprünglich genannt): Es kann, je nach Größe und Verbreitung der „Empfänger“ - Population, nach Anzahl der eingeschleppten Tiere, nach Generationsdauer und relativer Fitness der eingeschleppten wie der residierenden Genotypen mehrere bis sehr viele Jahre dauern, bis eine genetische Angleichung und eine wirkliche genetische „Homogenisierung“ erreicht ist (falls die eingeschleppten Organismen nicht vorzeitig eliminiert werden).
Sinnfällig wird das, wenn man sich vor Augen hält, wie lange bereits Menschen aller „Rassen“ sich vermischen, ohne dass wir alle nun bereits gleich aussehen.
Für die Wissenschaft störend ist allerdings bereits das lokale Miteinander und die teilweise Hybridisierung genetisch unterschiedlicher Teile der Gesamtpopulation einer Art.
*) Kleine Ergänzung: Auch Mutualismus wird in der Regel für das Zusammenleben unterschiedlicher Arten verwendet, in der Bedeutung "zum gegenseitigen Nutzen". Im Deutschen bezeichnen wir das als Symbiose. Im Englischen steht "symbiosis" dagegen für jede Form des regelmäßigen Zusammenlebens von Arten, einschließlich des Parasitismus und auch des Sozialparasitismus. - Terminologie ist eine Wissenschaft für sich!
MfG,
Merkur
Eine der älteren Arbeiten zum Thema, auf die ich mich bezog, ist 10 Jahre früher erschienen:
Foitzik, S., Heinze, J. 2000. Intraspecific parasitism and split sex ratios in a monogynous and monandrous ant. Behavioural Ecology and Sociobiology 47: 424-431. Untersucht wurde das an Temnothorax nylanderi.
Wiederholt habe ich es (auch in Forenbeiträgen) bereits bedauert, dass Fachbegriffe nicht „geschützt“ sind, dass jeder etwas anderes darunter verstehen kann.
„Parasitismus“ ist ein Leben auf Kosten eines Wirtes, und meines Erachtens sollte so etwas auf verschiedene Arten bezogen sein.
Andernfalls wären wir womöglich alle „intraspezifische Parasiten“: Beginnend als Endoparasiten im Uterus, dann als Ektoparasiten Körpersäfte der Mutter nuckelnd, dann unter Einsatz aller Mittel der Eltern im Kindes- und Jugendalter aufgezogen, schließlich als „Sozialparasiten“ von der Rente lebend. Dazwischen liegt eine selbständige Phase im Erwerbsalter, wo viele von uns dann als „Wirte“ das Leben der Jüngeren resp. Älteren alimentieren. Der Begriff „Mutualismus“*) scheint mir persönlich da besser geeignet.

Zu „Intraspez. Homogenisierung“ resp. „genetic homogenization“: Das bedeutet tatsächlich dasselbe.
Der Artikel von Oldenemail et al. 2004 (zitiert hier: viewtopic.php?f=23&t=738&p=5109#p5101 ) erschien in der Zeitschrift TREE („Trends in Ecology and Evolution“) im Januar 2004.
In demselben Jahr 2004 erschien mein Artikel „International Pet Ant Trade Increasing Risk and Danger in Europe – (Hymenoptera, Formicidae).” - Aliens 19&20, 24-26, sowie die deutsche Fassung in Myrmecological News, in der der deutsche Begriff „Intraspezifische Homogenisierung“ eingeführt wurde.
Die Autoren des TREE-Artikels konnten von meinen beiden Artikeln nichts wissen, und da diese auch eingereicht worden sind, bevor ich von dem TREE-Artikel Kenntnis bekam, konnte auch nicht kreuzweise zitiert werden. Auch die Referees haben mich nicht auf die Existenz des TREE-Beitrags hingewiesen. - So etwas ist in der wiss. Literatur halt Alltag.

Nicht vergessen darf man, dass der „Intraspezifischen Homogenisierung“ eine „intraspezifische Faunenverfälschung“ vorangeht (so hatte ich das ursprünglich genannt): Es kann, je nach Größe und Verbreitung der „Empfänger“ - Population, nach Anzahl der eingeschleppten Tiere, nach Generationsdauer und relativer Fitness der eingeschleppten wie der residierenden Genotypen mehrere bis sehr viele Jahre dauern, bis eine genetische Angleichung und eine wirkliche genetische „Homogenisierung“ erreicht ist (falls die eingeschleppten Organismen nicht vorzeitig eliminiert werden).
Sinnfällig wird das, wenn man sich vor Augen hält, wie lange bereits Menschen aller „Rassen“ sich vermischen, ohne dass wir alle nun bereits gleich aussehen.

Für die Wissenschaft störend ist allerdings bereits das lokale Miteinander und die teilweise Hybridisierung genetisch unterschiedlicher Teile der Gesamtpopulation einer Art.
*) Kleine Ergänzung: Auch Mutualismus wird in der Regel für das Zusammenleben unterschiedlicher Arten verwendet, in der Bedeutung "zum gegenseitigen Nutzen". Im Deutschen bezeichnen wir das als Symbiose. Im Englischen steht "symbiosis" dagegen für jede Form des regelmäßigen Zusammenlebens von Arten, einschließlich des Parasitismus und auch des Sozialparasitismus. - Terminologie ist eine Wissenschaft für sich!

MfG,
Merkur
- 2
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Two articles to read!
Nochmals zu der neuen Veröffentlichung über die Mikrogynen von Myrmica rubra:
Evidence that microgynes of Myrmica rubra ants are social parasites that attack old host colonies
S. SCHÄR & D. R. NASH
2014 EUROPEAN SOC IETY FOR EVOLUTIONARY BI OLOGY. J . EVOL. BIOL. d o i : 1 0 . 1 11 1 /j eb . 1 2 482
( viewtopic.php?f=23&t=738&p=5122#p5095 )
Vorab:
Längst nicht alle neuen Publikationen könnte ich derart gründlich beurteilen wie diese. Dazu fehlen Zeit und oft auch das Hintergrundwissen, das für eine treffendes Einschätzung notwendig wäre.
In diesem Fall jedoch war ich maßgeblich an früheren Untersuchungen des Mikrogynen-Problems beteiligt, kenne daher auch die meisten Details, und bin natürlich nach wie vor an einer überzeugenden Lösung interessiert!
Das Folgende ist sicher nicht für alle Leser spannend. Es mag aber u. a. zeigen, dass man wissenschaftliche Ergebnisse nicht kritiklos für unumstößlich wahr halten sollte! – Doch macht es viel Mühe, die problematischen Aussagen heraus zu arbeiten.
Inzwischen habe ich die gesamte Arbeit gelesen. Die ursprüngliche Beurteilung bleibt bestehen.
Im Einzelnen konnte ich feststellen, dass die Autoren entflügelte Gynen als „queens“ bezeichnen, ohne Berücksichtigung ihres reproduktiven Status. Ich habe seit 1967 immer wieder in Veröffentlichungen darauf hingewiesen, dass z. B. ein Volk mit einem halben Dutzend unbegatteter Gynen und einer einzigen reproduktiven Gyne eben nicht polygyn sondern monogyn ist. Es macht auch zweifellos einen Unterschied, ob man eine begattete oder eine unbegattete Mikrogyne (resp. eine Gyne eines „normalen“ Sozialparasiten) in ein Wirtsnest mit (makrogyner) Königin setzt, ganz entsprechend wie wenn man Kolonien selbständiger Arten mit begatteten oder unbegatteten Gynen zu gründen versucht. Dennoch behandeln viele Ameisenforscher eine entflügelte Gyne als „black box“ und unterstellen einfach, dass das Tier begattet und fertil ist.
Schär und Nash unterscheiden nun zwar zwischen „macrogyne queens“ und „macrogyne gynes“, und entsprechend bei den microgynes, doch bezieht sich das darauf, ob die Tiere aus der Brut von Makrogynen oder von Mikrogynen stammten. Der reproduktive Status der Gynen wurde auch hier nicht überprüft; wenn es keinen weiblichen Nachwuchs gab, konnte das eben auch daran liegen, dass die „Königin(nen)“ der Versuchsgruppe unbegattet war(en):
Vgl. Tabelle S1: http://onlinelibrary.wiley.com/store/10 ... 05279e9167
Da haben 10 von 13 Versuchsvölkchen mit mikrogyner „Königin“ weder Arbeiterinnen noch Mikrogynen produziert, drei haben 1-5 Mikrogynen und vier haben ein paar Arbeiterinnen produziert (darunter die drei, die auch Mikrogynen erzeugten). Das lässt die Vermutung aufkommen, dass etliche der mikrogynen „Königinnen“ einfach unbegattet waren, eventuell alle neun, die keinen weiblichen Nachwuchs hatten!
Meine Kenntnisse reichen nicht aus, um zu entscheiden, ob man in Unkenntnis des reproduktiven Status der Tiere diese in der Statistik alle als gleichwertig betrachten kann?
Unerfreulich (im Sinne wünschenswert klarer Definitionen) wird es in der Diskussion, wenn Raupen myrmekophiler Schmetterlinge (Bläulinge, z. B. Maculinea alcon) oder die Larven der Schwebfliegen-Gattung Microdon als „Sozialparasiten“ bezeichnet werden: Sie fressen Brut der Ameisen-Wirte und sind damit Räuber, auch wenn sie sich im Nest der Wirte betätigen! (Mit gleichem Recht könnte man die Hausmäuse in unseren Vorratskellern als Sozialparasiten auffassen, oder übliche Ekto- und Endoparasiten des Menschen: Sie leben auf Kosten des sozialen Homo sapiens, allerdings ohne dass sie uns ihren Nachwuchs zur Aufzucht in die Babybettchen legen).
Besonders interessiert haben mich das experimentelle Vorgehen und seine Durchführung im Jahreszyklus.
Die Völker wurden um Ende Juli/ Anfang August im Freiland gesammelt, zu einer Zeit als geflügelte Geschlechtstiere in den Nestern waren. „Microgyne queens“ wurden in 10 der gesamt 21 Nester angetroffen. Durchgezählt und sortiert wurden sie nach einem Aufenthalt von bis zu 4 Wochen bei 5-10°C (Ich kann leider nicht beurteilen, ob und wie sich eine solche Kaltlagerung mitten im Sommer eventuell auf die anschließenden Versuche ausgewirkt hat).
Die Völker wurden aufgeteilt in gesamt 96 kleinere Einheiten in vier Gruppen: (i) Nur eine Makrogyne; (ii) Eine Makrogyne und eine bis mehrere Mikrogynen; (iii) Eine Makrogyne aus einem Nest ohne Mikrogynen, dem Mikrogynen zugesetzt wurden; (iv) Nur Mikrogynen, jeweils aus einem Stammvolk.
Alle Versuchsvölkchen wurden mit je rund 50 Arbeiterinnen, jedoch ohne Brut angesetzt, so dass entstehende Brut von den jeweiligen Königinnen stammen musste.
Die Völkchen wurden über 20 Wochen im Dunklen und unter (m. E. geeigneten) Tagestemperatur-Rhythmen gehalten. Es folgte eine Überwinterung von 15 Wochen bei 4°C. Anschließend konnten die Tiere bei „Raumtemperatur“ für 5 Wochen die überwinterte Brut aufziehen.
Die Kolonien wurden wöchentlich einmal mit Bhatkar-diet und Mehlwürmern bzw. Fliegen gefüttert sowie befeuchtet. (Hierin unterscheiden sich viele wiss. Experimente. Wir haben z. B. grundsätzlich das Futter dreimal pro Woche gewechselt und dabei auch die Feuchtigkeit kontrolliert, sowie niemals Bhatkar-Whitcomb-Diät oder dergleichen eingesetzt. Honigwasser und Insektenteile waren Standard).
Diese Einzelheiten will ich nur mitteilen, da sie für die eigene Haltung von Myrmica rubra Anhaltspunkte geben können.
Die Ergebnisse im Einzelnen hier aufzuführen, würde zu weit führen; es ist eine sehr umfangreiche Arbeit mit sehr viel Statistik. Sie sind im Abstract (s. 2. Post in diesem Thread) zusammengefasst.
Die in meinen Augen fragwürdige Deutung der Mikrogynen von M. rubra als „intraspezifische Sozialparasiten“ (bzw. als „Sozialparasiten“ im Titel) habe ich oben bereits angesprochen.
Nochmals hinweisen möchte ich darauf, dass Meldungen von Freilandvorkommen solcher Mikrogynen äußerst interessant wären: Von einer befreundeten Arbeitsgruppe weiß ich, dass diese im nächsten Jahr sich des Themas noch einmal annehmen möchte. Was man dazu vor allem braucht, ist ein Vorkommen, dem man Versuchstiermaterial entnehmen kann!
MfG,
Merkur
Evidence that microgynes of Myrmica rubra ants are social parasites that attack old host colonies
S. SCHÄR & D. R. NASH
2014 EUROPEAN SOC IETY FOR EVOLUTIONARY BI OLOGY. J . EVOL. BIOL. d o i : 1 0 . 1 11 1 /j eb . 1 2 482
( viewtopic.php?f=23&t=738&p=5122#p5095 )
Vorab:
Längst nicht alle neuen Publikationen könnte ich derart gründlich beurteilen wie diese. Dazu fehlen Zeit und oft auch das Hintergrundwissen, das für eine treffendes Einschätzung notwendig wäre.
In diesem Fall jedoch war ich maßgeblich an früheren Untersuchungen des Mikrogynen-Problems beteiligt, kenne daher auch die meisten Details, und bin natürlich nach wie vor an einer überzeugenden Lösung interessiert!

Das Folgende ist sicher nicht für alle Leser spannend. Es mag aber u. a. zeigen, dass man wissenschaftliche Ergebnisse nicht kritiklos für unumstößlich wahr halten sollte! – Doch macht es viel Mühe, die problematischen Aussagen heraus zu arbeiten.
Inzwischen habe ich die gesamte Arbeit gelesen. Die ursprüngliche Beurteilung bleibt bestehen.
Im Einzelnen konnte ich feststellen, dass die Autoren entflügelte Gynen als „queens“ bezeichnen, ohne Berücksichtigung ihres reproduktiven Status. Ich habe seit 1967 immer wieder in Veröffentlichungen darauf hingewiesen, dass z. B. ein Volk mit einem halben Dutzend unbegatteter Gynen und einer einzigen reproduktiven Gyne eben nicht polygyn sondern monogyn ist. Es macht auch zweifellos einen Unterschied, ob man eine begattete oder eine unbegattete Mikrogyne (resp. eine Gyne eines „normalen“ Sozialparasiten) in ein Wirtsnest mit (makrogyner) Königin setzt, ganz entsprechend wie wenn man Kolonien selbständiger Arten mit begatteten oder unbegatteten Gynen zu gründen versucht. Dennoch behandeln viele Ameisenforscher eine entflügelte Gyne als „black box“ und unterstellen einfach, dass das Tier begattet und fertil ist.
Schär und Nash unterscheiden nun zwar zwischen „macrogyne queens“ und „macrogyne gynes“, und entsprechend bei den microgynes, doch bezieht sich das darauf, ob die Tiere aus der Brut von Makrogynen oder von Mikrogynen stammten. Der reproduktive Status der Gynen wurde auch hier nicht überprüft; wenn es keinen weiblichen Nachwuchs gab, konnte das eben auch daran liegen, dass die „Königin(nen)“ der Versuchsgruppe unbegattet war(en):
Vgl. Tabelle S1: http://onlinelibrary.wiley.com/store/10 ... 05279e9167
Da haben 10 von 13 Versuchsvölkchen mit mikrogyner „Königin“ weder Arbeiterinnen noch Mikrogynen produziert, drei haben 1-5 Mikrogynen und vier haben ein paar Arbeiterinnen produziert (darunter die drei, die auch Mikrogynen erzeugten). Das lässt die Vermutung aufkommen, dass etliche der mikrogynen „Königinnen“ einfach unbegattet waren, eventuell alle neun, die keinen weiblichen Nachwuchs hatten!
Meine Kenntnisse reichen nicht aus, um zu entscheiden, ob man in Unkenntnis des reproduktiven Status der Tiere diese in der Statistik alle als gleichwertig betrachten kann?
Unerfreulich (im Sinne wünschenswert klarer Definitionen) wird es in der Diskussion, wenn Raupen myrmekophiler Schmetterlinge (Bläulinge, z. B. Maculinea alcon) oder die Larven der Schwebfliegen-Gattung Microdon als „Sozialparasiten“ bezeichnet werden: Sie fressen Brut der Ameisen-Wirte und sind damit Räuber, auch wenn sie sich im Nest der Wirte betätigen! (Mit gleichem Recht könnte man die Hausmäuse in unseren Vorratskellern als Sozialparasiten auffassen, oder übliche Ekto- und Endoparasiten des Menschen: Sie leben auf Kosten des sozialen Homo sapiens, allerdings ohne dass sie uns ihren Nachwuchs zur Aufzucht in die Babybettchen legen).

Besonders interessiert haben mich das experimentelle Vorgehen und seine Durchführung im Jahreszyklus.
Die Völker wurden um Ende Juli/ Anfang August im Freiland gesammelt, zu einer Zeit als geflügelte Geschlechtstiere in den Nestern waren. „Microgyne queens“ wurden in 10 der gesamt 21 Nester angetroffen. Durchgezählt und sortiert wurden sie nach einem Aufenthalt von bis zu 4 Wochen bei 5-10°C (Ich kann leider nicht beurteilen, ob und wie sich eine solche Kaltlagerung mitten im Sommer eventuell auf die anschließenden Versuche ausgewirkt hat).
Die Völker wurden aufgeteilt in gesamt 96 kleinere Einheiten in vier Gruppen: (i) Nur eine Makrogyne; (ii) Eine Makrogyne und eine bis mehrere Mikrogynen; (iii) Eine Makrogyne aus einem Nest ohne Mikrogynen, dem Mikrogynen zugesetzt wurden; (iv) Nur Mikrogynen, jeweils aus einem Stammvolk.
Alle Versuchsvölkchen wurden mit je rund 50 Arbeiterinnen, jedoch ohne Brut angesetzt, so dass entstehende Brut von den jeweiligen Königinnen stammen musste.
Die Völkchen wurden über 20 Wochen im Dunklen und unter (m. E. geeigneten) Tagestemperatur-Rhythmen gehalten. Es folgte eine Überwinterung von 15 Wochen bei 4°C. Anschließend konnten die Tiere bei „Raumtemperatur“ für 5 Wochen die überwinterte Brut aufziehen.
Die Kolonien wurden wöchentlich einmal mit Bhatkar-diet und Mehlwürmern bzw. Fliegen gefüttert sowie befeuchtet. (Hierin unterscheiden sich viele wiss. Experimente. Wir haben z. B. grundsätzlich das Futter dreimal pro Woche gewechselt und dabei auch die Feuchtigkeit kontrolliert, sowie niemals Bhatkar-Whitcomb-Diät oder dergleichen eingesetzt. Honigwasser und Insektenteile waren Standard).
Diese Einzelheiten will ich nur mitteilen, da sie für die eigene Haltung von Myrmica rubra Anhaltspunkte geben können.
Die Ergebnisse im Einzelnen hier aufzuführen, würde zu weit führen; es ist eine sehr umfangreiche Arbeit mit sehr viel Statistik. Sie sind im Abstract (s. 2. Post in diesem Thread) zusammengefasst.
Die in meinen Augen fragwürdige Deutung der Mikrogynen von M. rubra als „intraspezifische Sozialparasiten“ (bzw. als „Sozialparasiten“ im Titel) habe ich oben bereits angesprochen.
Nochmals hinweisen möchte ich darauf, dass Meldungen von Freilandvorkommen solcher Mikrogynen äußerst interessant wären: Von einer befreundeten Arbeitsgruppe weiß ich, dass diese im nächsten Jahr sich des Themas noch einmal annehmen möchte. Was man dazu vor allem braucht, ist ein Vorkommen, dem man Versuchstiermaterial entnehmen kann!
MfG,
Merkur
- 3
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Two articles to read!
Vielen Dank fürs Interresse an unserer M. rubra Arbeit  Ich habe die Reaktionen mit Freude zur Kenntnis genommen und möchte hier einige Erkärungen anfügen um Missverständnisse zu vermeiden:
Ich habe die Reaktionen mit Freude zur Kenntnis genommen und möchte hier einige Erkärungen anfügen um Missverständnisse zu vermeiden:
Unter einem Sozialparasiten verstehen wir einen Parasiten welcher die geteilten Resourcen und kollektive Jungenaufzucht einer Kolonie miteinander (aber nicht mit dem SP!) verwandter Tiere unerkannt ausnützt um eigene Nachkommen anstelle derjeniger der “geprellten” Wirtskolonie aufziehen zu lassen.
In unserer Studie kamen wir zum Schluss dass es sich zumindest bei den in unseren Populationen gefundenen M. rubra Mikrogynen um Sozialparasiten handelt. Wir begründeten unsere Schlussfolgerung damit dass die zusätzliche Anwesenheit von Mikrogynen in standartisierten Nestern (1 Makrogynen-Königin, 50 Arbeiterinnen) langfristig zu einer signifikanten reduktion der Nestgrössen im Vergleich mikrogynenfreien aber sonst identischen Nestern geführt hat (Grafik 3a). Dieser negative Einfluss der Mikrogynen auf das Wachstum der Nester in welchen sie vorkommen lassen eine "gute Gesinnung" der Mikrogynen als wenig wahrscheinlich erscheinen. Die Mikrogynen und ihre Larven zweigen offenbar Resourcen von ihren Wirtskolonien ab was die Wirtskolonie messbar schwächt.
Entscheidend dazu ist auch dass wir die schon oft berichtete genetische Verschiedenheit der Mikrogynen von den Makrogynen in der gleichen Population und in den gleichen Nestern für unsere Population bestätigen konnten (Grafik 1). Dies bedeutet dass die Mikrogynen und ihre Männchen, obwohl sie zwar zur selben Art gehören wie ihre Wirte, doch so etwas wie eine lokale Rasse darstellen welche sich nicht oder kaum mit den Makrogynen und deren Männchen im gleichen Nest paaren.
Dies erklärt aus evolutionärer Sicht weshalb die Mikrogynen andere Interessen verfolgen als die mit Ihnen nicht direkt verwandten Makrogynen. Diese reproduktive Isolation zwischen Parasit und Wirt ist der grundlegende Unterschied zur Sichelzellenanämie und ähnlichen Analogien bei welchen es sich um eine Überlebensstrategie von ein und derselben sich frei paarenden Population handelt.
Intraspezifischer Sozialparastismus ist keine Worthülse ohne Definition: Wir verstehen darunter parasitische Populationen von polygynen Arten welche von ihrer Wirtspopulation in derselben Kolonie reproduktiv isoliert sind. Solche Populationen stellen vermutlich die Vorläufer von Sozialparasitischen Arten dar, denn diese sind ja bekanntlich oft mit ihren Wirten nahe verwandt. Genau einen solchen Ûbergang von ursprünglich nicht parasitischen Mikrogynen zu einer sozialparasitischen Art schlagen wir in unserer Arbeit für M. rubra vor.
Ich freue mich über alle Reaktionen und bin gespannt was weitere Arbeiten zu diesem interessanten Thema noch an Überraschungen hervorbringen
Mit freundlichen Grüssen,
ss
 Ich habe die Reaktionen mit Freude zur Kenntnis genommen und möchte hier einige Erkärungen anfügen um Missverständnisse zu vermeiden:
Ich habe die Reaktionen mit Freude zur Kenntnis genommen und möchte hier einige Erkärungen anfügen um Missverständnisse zu vermeiden:Unter einem Sozialparasiten verstehen wir einen Parasiten welcher die geteilten Resourcen und kollektive Jungenaufzucht einer Kolonie miteinander (aber nicht mit dem SP!) verwandter Tiere unerkannt ausnützt um eigene Nachkommen anstelle derjeniger der “geprellten” Wirtskolonie aufziehen zu lassen.
In unserer Studie kamen wir zum Schluss dass es sich zumindest bei den in unseren Populationen gefundenen M. rubra Mikrogynen um Sozialparasiten handelt. Wir begründeten unsere Schlussfolgerung damit dass die zusätzliche Anwesenheit von Mikrogynen in standartisierten Nestern (1 Makrogynen-Königin, 50 Arbeiterinnen) langfristig zu einer signifikanten reduktion der Nestgrössen im Vergleich mikrogynenfreien aber sonst identischen Nestern geführt hat (Grafik 3a). Dieser negative Einfluss der Mikrogynen auf das Wachstum der Nester in welchen sie vorkommen lassen eine "gute Gesinnung" der Mikrogynen als wenig wahrscheinlich erscheinen. Die Mikrogynen und ihre Larven zweigen offenbar Resourcen von ihren Wirtskolonien ab was die Wirtskolonie messbar schwächt.
Entscheidend dazu ist auch dass wir die schon oft berichtete genetische Verschiedenheit der Mikrogynen von den Makrogynen in der gleichen Population und in den gleichen Nestern für unsere Population bestätigen konnten (Grafik 1). Dies bedeutet dass die Mikrogynen und ihre Männchen, obwohl sie zwar zur selben Art gehören wie ihre Wirte, doch so etwas wie eine lokale Rasse darstellen welche sich nicht oder kaum mit den Makrogynen und deren Männchen im gleichen Nest paaren.
Dies erklärt aus evolutionärer Sicht weshalb die Mikrogynen andere Interessen verfolgen als die mit Ihnen nicht direkt verwandten Makrogynen. Diese reproduktive Isolation zwischen Parasit und Wirt ist der grundlegende Unterschied zur Sichelzellenanämie und ähnlichen Analogien bei welchen es sich um eine Überlebensstrategie von ein und derselben sich frei paarenden Population handelt.
Intraspezifischer Sozialparastismus ist keine Worthülse ohne Definition: Wir verstehen darunter parasitische Populationen von polygynen Arten welche von ihrer Wirtspopulation in derselben Kolonie reproduktiv isoliert sind. Solche Populationen stellen vermutlich die Vorläufer von Sozialparasitischen Arten dar, denn diese sind ja bekanntlich oft mit ihren Wirten nahe verwandt. Genau einen solchen Ûbergang von ursprünglich nicht parasitischen Mikrogynen zu einer sozialparasitischen Art schlagen wir in unserer Arbeit für M. rubra vor.
Ich freue mich über alle Reaktionen und bin gespannt was weitere Arbeiten zu diesem interessanten Thema noch an Überraschungen hervorbringen

Mit freundlichen Grüssen,
ss
- 6
- argus
- Mitglied
- Beiträge: 3
- Registriert: Mittwoch 19. November 2014, 22:19
- Bewertung: 11
Re: Two articles to read!
In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, ob und wie ihr evtl. unterschiedliches Verhalten der Nachkommen der Micro als auch der Makrogynen untersucht habt.
Ist hier denn auch ein unterschiedliches Verhalten der Arbeiterinnen vorhanden oder zeigt sich das alles nur in einer Schwächung der Entwicklung.
Parasiten agieren ja mitunter anders als die Wirte. Die beteiligen sich nicht oder kaum an Nahrungssuche etc.
Ist hier denn auch ein unterschiedliches Verhalten der Arbeiterinnen vorhanden oder zeigt sich das alles nur in einer Schwächung der Entwicklung.
Parasiten agieren ja mitunter anders als die Wirte. Die beteiligen sich nicht oder kaum an Nahrungssuche etc.
- 0
-

Trailandstreet - Mitglied
- Beiträge: 1174
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 21:02
- Wohnort: Ho'mbua
- Bewertung: 1693
Re: Two articles to read!
Hallo Argus,
Sehr schön, dass wir auf diese Weise in Kontakt kommen. Es könnte eine lebhafte Diskussion werden!
Nur für solche Arten hat er die Hypothese formuliert, wonach die Sozialparasiten „alle“ aus ihrer jeweiligen Wirtsart hervorgegangen sind (das war nicht zutreffend, da Sozialparasiten wie Sklavenhalter oft mehrere Wirtsarten haben, und einige Wirtsarten mehrere Sozialparasiten-Arten, z. B. Leptothorax acervorum. In meinem Review 2009 in MN ausführlich dargelegt). Nicht nur für Inquilinen, auch für Duloten und die temporären Parasiten trifft die enge Verwandtschaft mit der jeweiligen Wirtsgattung zu.
Wenn ich mich recht erinnere, sind einzelne „microrubra“ – Populationen ihren jeweiligen Wirtspopulationen genetisch ähnlicher als entfernteren „microrubra“-Populationen.
Eure Aufzuchtversuche erbrachten, wie mir scheint, ähnlich verwirrende Ergebnisse, wie ich sie erhielt. Eine frühe Arbeit dazu habe ich 1997 (leider!) in einer kleinen Zeitschrift versteckt, wo sie weitgehend übersehen wird: Buschinger, A. (1997): Vorkommen der sozialparasitischen Ameise Myrmica microrubra in Hessen (Hymenoptera, Formicidae). Hessische Faunistische Briefe 16, 49-57. (Die Zeitschrift ist seit 2008 eingestellt).
Edit: Habe den Artikel im Ameisenwiki gepostet: http://ameisenwiki.de/index.php/Myrmica ... microrubra
Allgemein hat man ja vielfach versucht, Merkmale von Sozialparasiten einzeln herzuleiten, etwa Sklavenraub aus Brutraub zu Nahrungszwecken; geringe Größe der Parasiten usw. – Ich bin der Meinung, dass eine sozialparasitische Art mit allen Eigenschaften, insbesondere mit der parasitischen Koloniegründung, entstehen muss. Und das geht am einfachsten wohl über die Entstehung aus einer polygynen Stammform. Gewiss, es muss dann intraspezifisch Genotypen geben, die von der Stammform +/- isoliert sind (mein „preparasite“ in „Sympatric speciation and radiative evolution of socially parasitic ants - Heretic hypotheses and their factual background. Z. zool. Syst. Evolut.-forsch. 28, 241-260, 1990) und da würde M. microrubra gut passen.
Doch gibt es ziemlich viele Zweifel, die mich (und auch die Schlick-Steiners in Innsbruck) noch immer nach einer alternativen Erklärung suchen lassen. Nicht zuletzt stört mich das räumlich und (nur scheinbar?) auch zeitlich so unberechenbare Auftreten von Mikrogynen.
Eine konkrete Frage habe ich aber zum Schluss:
Ich hoffe, ich habe es hier viewtopic.php?f=23&t=738&p=5175#p5158 richtig wiedergegeben, dass Ihr am Ende der Zuchtversuche nicht geprüft habt, ob die verwendeten Mikrogynen begattet und fertil waren?
In meiner o. g. Arbeit von 1997 konnte ich feststellen, dass ein Teil auch der entflügelten Mikrogynen aus dem Freiland unbegattet waren, ebenso wie in M. rubra- Völkern auch immer wieder unbegattete Makrogynen vorkommen.
Vieles bei M. rubra-Mikrogynen passt einfach nicht zu dem, was ich an sehr zahlreichen Sozialparasiten-Arten beobachten konnte.
So viel im Moment.
Viele Grüße,
Merkur
Sehr schön, dass wir auf diese Weise in Kontakt kommen. Es könnte eine lebhafte Diskussion werden!

Es ist nach meinem Verständnis ein Begriff, der von verschiedenen Autoren mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt wird, also eine „Hülse“, eine Verpackung für unterschiedliche Inhalte. (Ganz schlimm m. E. der Fall bei „queen“, „worker“, „caste“ und weiteren fundamentalen Begriffen aus der Sozialinsekten-Forschung; hat zu vielen Missverständnissen geführt).Intraspezifischer Sozialparastismus ist keine Worthülse ohne Definition.
Das ist eine m.W. neue Definition! – Aber wie ich immer wieder zum Ausdruck bringe, sind Begriffe wie „Sozialparasitismus“ nicht „geschützt“, und jedem Autor steht es frei, sie mit eigenen Inhalten zu füllen. – Emery verstand halt darunter die Ausbeutung des sozialen Verhaltens einer Art durch eine andere (zumindest ehemals) soziale Art (wobei er die Gastameisen, Xenobionten, nicht mit eingezogen hat). – Er kannte damals noch nicht viele Arten sozialparasitischer Ameisen.Unter einem Sozialparasiten verstehen wir einen Parasiten welcher die geteilten Resourcen und kollektive Jungenaufzucht einer Kolonie miteinander (aber nicht mit dem SP!) verwandter Tiere unerkannt ausnützt um eigene Nachkommen anstelle derjeniger der “geprellten” Wirtskolonie aufziehen zu lassen.
Nur für solche Arten hat er die Hypothese formuliert, wonach die Sozialparasiten „alle“ aus ihrer jeweiligen Wirtsart hervorgegangen sind (das war nicht zutreffend, da Sozialparasiten wie Sklavenhalter oft mehrere Wirtsarten haben, und einige Wirtsarten mehrere Sozialparasiten-Arten, z. B. Leptothorax acervorum. In meinem Review 2009 in MN ausführlich dargelegt). Nicht nur für Inquilinen, auch für Duloten und die temporären Parasiten trifft die enge Verwandtschaft mit der jeweiligen Wirtsgattung zu.
Bei einem Teil der einschlägigen Arbeiten war ich ja beteiligt, kenne sie also. Die genetische Verschiedenheit rubra – „microrubra“ ist nach wie vor „störend“ bzw. nicht richtig erklärlich.Entscheidend dazu ist auch dass wir die schon oft berichtete genetische Verschiedenheit der Mikrogynen von den Makrogynen in der gleichen Population und in den gleichen Nestern für unsere Population bestätigen konnten (Grafik 1)
Wenn ich mich recht erinnere, sind einzelne „microrubra“ – Populationen ihren jeweiligen Wirtspopulationen genetisch ähnlicher als entfernteren „microrubra“-Populationen.
Eure Aufzuchtversuche erbrachten, wie mir scheint, ähnlich verwirrende Ergebnisse, wie ich sie erhielt. Eine frühe Arbeit dazu habe ich 1997 (leider!) in einer kleinen Zeitschrift versteckt, wo sie weitgehend übersehen wird: Buschinger, A. (1997): Vorkommen der sozialparasitischen Ameise Myrmica microrubra in Hessen (Hymenoptera, Formicidae). Hessische Faunistische Briefe 16, 49-57. (Die Zeitschrift ist seit 2008 eingestellt).
Edit: Habe den Artikel im Ameisenwiki gepostet: http://ameisenwiki.de/index.php/Myrmica ... microrubra
Polygynie als Ausgangspunkt der Evolution der Sozialparasiten habe ich ja in mehreren Arbeiten postuliert, s. MN 2009 und darin zitierte Veröffentlichungen. Natürlich habe ich auch diese Möglichkeit für die Mikrogynen von M. rubra in Erwägung gezogen.Intraspezifischer Sozialparastismus ist keine Worthülse ohne Definition: Wir verstehen darunter parasitische Populationen von polygynen Arten welche von ihrer Wirtspopulation in derselben Kolonie reproduktiv isoliert sind. Solche Populationen stellen vermutlich die Vorläufer von Sozialparasitischen Arten dar, denn diese sind ja bekanntlich oft mit ihren Wirten nahe verwandt. Genau einen solchen Ûbergang von ursprünglich nicht parasitischen Mikrogynen zu einer sozialparasitischen Art schlagen wir in unserer Arbeit für M. rubra vor.
Allgemein hat man ja vielfach versucht, Merkmale von Sozialparasiten einzeln herzuleiten, etwa Sklavenraub aus Brutraub zu Nahrungszwecken; geringe Größe der Parasiten usw. – Ich bin der Meinung, dass eine sozialparasitische Art mit allen Eigenschaften, insbesondere mit der parasitischen Koloniegründung, entstehen muss. Und das geht am einfachsten wohl über die Entstehung aus einer polygynen Stammform. Gewiss, es muss dann intraspezifisch Genotypen geben, die von der Stammform +/- isoliert sind (mein „preparasite“ in „Sympatric speciation and radiative evolution of socially parasitic ants - Heretic hypotheses and their factual background. Z. zool. Syst. Evolut.-forsch. 28, 241-260, 1990) und da würde M. microrubra gut passen.
Doch gibt es ziemlich viele Zweifel, die mich (und auch die Schlick-Steiners in Innsbruck) noch immer nach einer alternativen Erklärung suchen lassen. Nicht zuletzt stört mich das räumlich und (nur scheinbar?) auch zeitlich so unberechenbare Auftreten von Mikrogynen.
Eine konkrete Frage habe ich aber zum Schluss:
Ich hoffe, ich habe es hier viewtopic.php?f=23&t=738&p=5175#p5158 richtig wiedergegeben, dass Ihr am Ende der Zuchtversuche nicht geprüft habt, ob die verwendeten Mikrogynen begattet und fertil waren?
In meiner o. g. Arbeit von 1997 konnte ich feststellen, dass ein Teil auch der entflügelten Mikrogynen aus dem Freiland unbegattet waren, ebenso wie in M. rubra- Völkern auch immer wieder unbegattete Makrogynen vorkommen.
Vieles bei M. rubra-Mikrogynen passt einfach nicht zu dem, was ich an sehr zahlreichen Sozialparasiten-Arten beobachten konnte.
So viel im Moment.

Viele Grüße,
Merkur
- 2
Zuletzt geändert von Merkur am Freitag 21. November 2014, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Two articles to read!
Die im vorhergehenden Beitrag erwähnte Arbeit habe ich gescannt und im Ameisenwiki gepostet:
http://ameisenwiki.de/index.php/Myrmica ... D_M._rubra
(Buschinger, A. (1997): Vorkommen der sozialparasitischen Ameise Myrmica microrubra in Hessen (Hymenoptera, Formicidae). Hessische Faunistische Briefe 16, 49-57.)
Merkur
http://ameisenwiki.de/index.php/Myrmica ... D_M._rubra
(Buschinger, A. (1997): Vorkommen der sozialparasitischen Ameise Myrmica microrubra in Hessen (Hymenoptera, Formicidae). Hessische Faunistische Briefe 16, 49-57.)
Merkur
- 2
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Two articles to read!
@Franz: Gute Frage. Über das Verhalten der Mikrogynen-Arbeiterinnen ist nach wie vor sehr wenig bekannt. Fest steht nur dass diese eindeutig existieren und dass sie sich soweit mir bekannt ist äusserlich nicht von “normalen” M. rubra Arbeiterinnen unterscheiden lassen, schon gar nicht im lebenden Zustand. Es liesse sich bei der Beobachtung von Mikrogynen-Makrogynen-gemischten Nestern also nicht sagen welches die Mikrogynen-Arbeiterinnen sind, falls sie denn vorhanden sind. Man könnte natürlich z. B. Arbeiterinnen von 2 reinen Nestern der beiden Formen individuell markieren und dann zur Fusion bewegen. Wäre nicht ganz unaufwändig aber sicher sehr interessant  Bei unserem Experiment konnten wir allerdings erkennen dass das Vorhandensein von Larven in gemischten Nestern weniger konstant war als in denen mit nur Makroynen-Königinnen. Dies könnte eventuell auf Brutraub der beiden genetischen Linien an Larven der jeweils anderen Linie hindeuten.
Bei unserem Experiment konnten wir allerdings erkennen dass das Vorhandensein von Larven in gemischten Nestern weniger konstant war als in denen mit nur Makroynen-Königinnen. Dies könnte eventuell auf Brutraub der beiden genetischen Linien an Larven der jeweils anderen Linie hindeuten.
Die Mikrogynen selber agieren aber durchaus anders als ihre Wirte: Wie schon von G. W. Elmes (1976) festgestellt wurde neigen sie zu einer extrem überhöhten Produktion von Geschlechtstieren (bis 40x mehr als die Makrogynen produzieren). In Extremfällen von Nestern im “Endstadium” findet man sogar fast ausschliesslich nur noch Geschlechtstiere. Wenn man dazu noch bedenkt dass sie mit den Makrogynen sowie deren Männchen & Arbeiterinnen im selben Nest gar nicht direkt verwandt sind (also nicht deren Gene weitergeben) wird schnell klar dass die Anwesenheit dieser Mikrogynen kaum im evolutionären Interesse der betroffenen “normalen” M. rubra Kolonien sein dürfte – es sich also um Parasiten handelt.
@Merkur: Das freut mich auch sehr und ist für mich auch eine gewisse Ehre. Ich habe Ihre Arbeiten schon als Jugendlicher mit grossem Interresse und Bewunderung gelesen. Für eine Diskussion bin ich gerne offen solange ich Zeit dazu finde
Zur Definitionsfrage: Die von uns verwendete Definition von (intraspezifischem) Sozialparasitismus ist nicht neu, sondern geht auf die Referenz: Nash D. R. & Boomsma J. J. 2008. Communication between hosts and Social Parasites. In Sociobiology of Communication: an Interdisciplinary Perspective (P. d’Ettorre & D. Hughes, eds.), chap. 4, pp 55-79. Oxford University Press, London. 346 p. zurück, welche an entsprechender Stelle zitiert wurde.
Die genetische Situation bei M rubra/”microrubra” ist tatsächlich noch schlecht verstanden. Interressant wären allfällige Studien bei denen modernere DNA Sequenzierungsmethoden zum Einsatz kämen (Stichwort “RAD Sequencing” oder “GBS”). Diese neuen Methoden können einen viel repräsentativeren Teil des Genoms entschlüsseln als die bis anhin gebräuchlichen. Hier kommt es in jüngster Zeit zu Überraschungen, d. h. in einigen wenn auch nicht allen Fällen wo Arten bereits aufgrund “herkömmlicher” Genetik synonymisiert wurden werden diese durch diese ganz neuen Methoden nun scheinbar doch wieder als gute Arten unterstützt! Hier bin ich sehr gespannt was die Zukunft für “M. microrubra” (zurück?)bringen könnte Denkbar ist aber auch dass die Mikrogynen genetische Linien sind, welche sich immer wieder von M. rubra abspalten. Dies würde dann eher auf ein frühes Stadium der Artbildung hinweisen was ich persönlich nicht weniger spannend fände.
Denkbar ist aber auch dass die Mikrogynen genetische Linien sind, welche sich immer wieder von M. rubra abspalten. Dies würde dann eher auf ein frühes Stadium der Artbildung hinweisen was ich persönlich nicht weniger spannend fände.
Die Arbeit über “M. microrubra” in Hessen welche mir vorher nicht bekannt war habe ich nun mit grossem Interresse gelesen (danke). Paralellen zu unserer Arbeit konnte ich darin aber wenige erkennen. Was mir allerdings sofort auffiel ist folgender Absatz:
Aus eigener Erfahrung aus Dänemark kann ich da nur zustimmen. Myrmica rubra ist hier keineswegs eine der häufigsten Ameisen und fast auschliesslich auf nasse Wiesen und angrenzende Heidegebiete beschränkt, dort kann die Nestdichte aber die mir aus Mitteleuropa bekannten Verhältnisse bei weitem übersteigen! Während meiner Doktorarbeit habe ich M. rubra in weiten teilen Dänemarks gesammelt auch im Zusammenhang mit einer noch nicht veröffentlichten Studie. Immer im Spätsommer wenn die geflügelten Tiere leicht erkennbar sind, sowohl in grossen wie auch kleinen, isolierten Vorkommen. In dieser Zeit habe ich vier Vorkommen von “M. microrubra” entdeckt und alle vier liegen in einigen der grössten und dichtesten M. rubra Populationen die ich bisher kenne. Ich verfüge sogar über Daten welche zeigen dass das Auftreten von Mikrogynen mit der Nestdichte innerhalb der Wiesen hochgradig korreliert! Dies also als Tipp für die Suche nach neuen Vorkommen
Die Arbeit „Sympatric speciation and radiative evolution of socially parasitic ants - Heretic hypotheses and their factual background. Z. zool. Syst. Evolut.-forsch. 28, 241-260, 1990” sowie die darin vorgeschlagenen “preparasitic stages” haben zumindest mich bei der Interpretation unserer Resultate tatsächlich wesentlich beeinflusst!
Wir haben aus Zeitgründen und der Menge an Material die Fertilität der entflügelten Mikrogynen nicht überprüft, diesen Umstand aber in der Interpretation unserer Resultate berücksichtigt. Die Anwesenheit von entflügelten Mikrogynen hat die betroffenen, mit Makrogynen gemischten Nester geschwächt. Die Mikrogynen lebten also auf Kosten dieser nicht mit ihnen verwandten Makrogynen-Völker (was sie zu Parasiten macht) auch wenn nicht fertile Tiere darunter waren. Ich möchte aber auch auf unsere Transfektionsexperimente hinweisen bei welchen wir wenige entflügelte Mikrogyne(n) in ein standartisiertes Nest (1 Makrogyne, 50 Arbeiterinnen) künstlich einschleusten. Diese Versuchsnest-Gruppe wies eine signifikant reduzierte Produktion von Arbeiterinnenpuppen im Vergleich zu identischen Nestern ohne eingeschleuste Mikrogynen auf. Ich gehe davon aus dass wir im Falle von nicht fertilen Mikrogynen die Virulenz von “microrubra” eher noch unterschätzten und dass der negative Einfluss der Mikrogynen noch ausgeprägter gewesen wäre, wären alle Mikrogynen fertil gewesen.
Was die reinen Mikrogynen-Kolonien angeht haben wir darauf hingewiesen dass zu unserer Überraschung einige dieser Nester in Abwesenheit von Wirten normale Mengen von Arbeiterinnen produziert haben. Wir interpretierten dies als Möglichkeit dass es sich bei “M. microrubra” eventuell erst um so etwas wie einen fakultativen Parasiten handeln könnte der zumindest zeitweise auf sich allein gestellt überleben könnte – obwohl die meisten Nester im Feld beide Königinnenmorphen zu beherbergen scheinen. Aber hier beginnt die Spekulation.
Weiterhin nach alternativen Erklärungen zu suchen verbieten wir natürlich niemandem
Viele Grüsse!
\S
p.s. Die Idee die Geschichte von “M. microrubra” auf Ameisenwiki festzuhalten finde ich sehr gut! Allerdings finde ich es schade dass die Arbeiten vor 2005 noch fehlen.
 Bei unserem Experiment konnten wir allerdings erkennen dass das Vorhandensein von Larven in gemischten Nestern weniger konstant war als in denen mit nur Makroynen-Königinnen. Dies könnte eventuell auf Brutraub der beiden genetischen Linien an Larven der jeweils anderen Linie hindeuten.
Bei unserem Experiment konnten wir allerdings erkennen dass das Vorhandensein von Larven in gemischten Nestern weniger konstant war als in denen mit nur Makroynen-Königinnen. Dies könnte eventuell auf Brutraub der beiden genetischen Linien an Larven der jeweils anderen Linie hindeuten.Die Mikrogynen selber agieren aber durchaus anders als ihre Wirte: Wie schon von G. W. Elmes (1976) festgestellt wurde neigen sie zu einer extrem überhöhten Produktion von Geschlechtstieren (bis 40x mehr als die Makrogynen produzieren). In Extremfällen von Nestern im “Endstadium” findet man sogar fast ausschliesslich nur noch Geschlechtstiere. Wenn man dazu noch bedenkt dass sie mit den Makrogynen sowie deren Männchen & Arbeiterinnen im selben Nest gar nicht direkt verwandt sind (also nicht deren Gene weitergeben) wird schnell klar dass die Anwesenheit dieser Mikrogynen kaum im evolutionären Interesse der betroffenen “normalen” M. rubra Kolonien sein dürfte – es sich also um Parasiten handelt.
@Merkur: Das freut mich auch sehr und ist für mich auch eine gewisse Ehre. Ich habe Ihre Arbeiten schon als Jugendlicher mit grossem Interresse und Bewunderung gelesen. Für eine Diskussion bin ich gerne offen solange ich Zeit dazu finde

Zur Definitionsfrage: Die von uns verwendete Definition von (intraspezifischem) Sozialparasitismus ist nicht neu, sondern geht auf die Referenz: Nash D. R. & Boomsma J. J. 2008. Communication between hosts and Social Parasites. In Sociobiology of Communication: an Interdisciplinary Perspective (P. d’Ettorre & D. Hughes, eds.), chap. 4, pp 55-79. Oxford University Press, London. 346 p. zurück, welche an entsprechender Stelle zitiert wurde.
Die genetische Situation bei M rubra/”microrubra” ist tatsächlich noch schlecht verstanden. Interressant wären allfällige Studien bei denen modernere DNA Sequenzierungsmethoden zum Einsatz kämen (Stichwort “RAD Sequencing” oder “GBS”). Diese neuen Methoden können einen viel repräsentativeren Teil des Genoms entschlüsseln als die bis anhin gebräuchlichen. Hier kommt es in jüngster Zeit zu Überraschungen, d. h. in einigen wenn auch nicht allen Fällen wo Arten bereits aufgrund “herkömmlicher” Genetik synonymisiert wurden werden diese durch diese ganz neuen Methoden nun scheinbar doch wieder als gute Arten unterstützt! Hier bin ich sehr gespannt was die Zukunft für “M. microrubra” (zurück?)bringen könnte
 Denkbar ist aber auch dass die Mikrogynen genetische Linien sind, welche sich immer wieder von M. rubra abspalten. Dies würde dann eher auf ein frühes Stadium der Artbildung hinweisen was ich persönlich nicht weniger spannend fände.
Denkbar ist aber auch dass die Mikrogynen genetische Linien sind, welche sich immer wieder von M. rubra abspalten. Dies würde dann eher auf ein frühes Stadium der Artbildung hinweisen was ich persönlich nicht weniger spannend fände.Die Arbeit über “M. microrubra” in Hessen welche mir vorher nicht bekannt war habe ich nun mit grossem Interresse gelesen (danke). Paralellen zu unserer Arbeit konnte ich darin aber wenige erkennen. Was mir allerdings sofort auffiel ist folgender Absatz:
Demgegenüber erstaunt besonders das Verbreitungsbild von M. microrubra im Vergleich zu anderen, sicheren Inquilinen. Solche finden sich nach allen Erfahrungen des Verfassers fast immer nur in Bereichen mit genügend hoher Populationsdichte ihrer Wirtsart. Dazwischenliegende Populationen der Selbständigen Art mit geringerer Dichte sind frei von den Parasiten….
Aus eigener Erfahrung aus Dänemark kann ich da nur zustimmen. Myrmica rubra ist hier keineswegs eine der häufigsten Ameisen und fast auschliesslich auf nasse Wiesen und angrenzende Heidegebiete beschränkt, dort kann die Nestdichte aber die mir aus Mitteleuropa bekannten Verhältnisse bei weitem übersteigen! Während meiner Doktorarbeit habe ich M. rubra in weiten teilen Dänemarks gesammelt auch im Zusammenhang mit einer noch nicht veröffentlichten Studie. Immer im Spätsommer wenn die geflügelten Tiere leicht erkennbar sind, sowohl in grossen wie auch kleinen, isolierten Vorkommen. In dieser Zeit habe ich vier Vorkommen von “M. microrubra” entdeckt und alle vier liegen in einigen der grössten und dichtesten M. rubra Populationen die ich bisher kenne. Ich verfüge sogar über Daten welche zeigen dass das Auftreten von Mikrogynen mit der Nestdichte innerhalb der Wiesen hochgradig korreliert! Dies also als Tipp für die Suche nach neuen Vorkommen

Die Arbeit „Sympatric speciation and radiative evolution of socially parasitic ants - Heretic hypotheses and their factual background. Z. zool. Syst. Evolut.-forsch. 28, 241-260, 1990” sowie die darin vorgeschlagenen “preparasitic stages” haben zumindest mich bei der Interpretation unserer Resultate tatsächlich wesentlich beeinflusst!
Wir haben aus Zeitgründen und der Menge an Material die Fertilität der entflügelten Mikrogynen nicht überprüft, diesen Umstand aber in der Interpretation unserer Resultate berücksichtigt. Die Anwesenheit von entflügelten Mikrogynen hat die betroffenen, mit Makrogynen gemischten Nester geschwächt. Die Mikrogynen lebten also auf Kosten dieser nicht mit ihnen verwandten Makrogynen-Völker (was sie zu Parasiten macht) auch wenn nicht fertile Tiere darunter waren. Ich möchte aber auch auf unsere Transfektionsexperimente hinweisen bei welchen wir wenige entflügelte Mikrogyne(n) in ein standartisiertes Nest (1 Makrogyne, 50 Arbeiterinnen) künstlich einschleusten. Diese Versuchsnest-Gruppe wies eine signifikant reduzierte Produktion von Arbeiterinnenpuppen im Vergleich zu identischen Nestern ohne eingeschleuste Mikrogynen auf. Ich gehe davon aus dass wir im Falle von nicht fertilen Mikrogynen die Virulenz von “microrubra” eher noch unterschätzten und dass der negative Einfluss der Mikrogynen noch ausgeprägter gewesen wäre, wären alle Mikrogynen fertil gewesen.
Was die reinen Mikrogynen-Kolonien angeht haben wir darauf hingewiesen dass zu unserer Überraschung einige dieser Nester in Abwesenheit von Wirten normale Mengen von Arbeiterinnen produziert haben. Wir interpretierten dies als Möglichkeit dass es sich bei “M. microrubra” eventuell erst um so etwas wie einen fakultativen Parasiten handeln könnte der zumindest zeitweise auf sich allein gestellt überleben könnte – obwohl die meisten Nester im Feld beide Königinnenmorphen zu beherbergen scheinen. Aber hier beginnt die Spekulation.
Weiterhin nach alternativen Erklärungen zu suchen verbieten wir natürlich niemandem

Viele Grüsse!
\S
p.s. Die Idee die Geschichte von “M. microrubra” auf Ameisenwiki festzuhalten finde ich sehr gut! Allerdings finde ich es schade dass die Arbeiten vor 2005 noch fehlen.
- 3
- argus
- Mitglied
- Beiträge: 3
- Registriert: Mittwoch 19. November 2014, 22:19
- Bewertung: 11
Re: Two articles to read!
Hallo argus,
Zur Definitionsfrage:
– Und natürlich konnte der Beitrag nur meinen Kenntnisstand von 1997 wiedergeben, vor 17 Jahren. Ist aber im wesentlichen so geblieben…

Meine Vermutung geht in Richtung einer Störung in der Morphendetermination (Nicht: Kastendetermination! Kasten definiere ich nach der Funktion).
U. a. haben wir auch den Karyotyp bei rubra und microrubra verglichen; er ist identisch, s.u..
Ein Verdacht war, dass rubra ehemals eine Chromosomenzahl-Verdopplung durchgemacht haben könnte, und dass microrubra ein Atavismus, ein „Rückfall“ auf die ursprüngliche Chromosomenzahl, sein könnte.
viewtopic.php?f=50&t=79&p=5235#p5235
Buschinger,A. (1997): Ist Myrmica microrubra eine sozialparasitische Ameise? in: Soziale Insekten, IUSSI-Tagung Graz 1997, p. 25, K. Crailsheim & A. Stabentheiner (Hrsg.):
In diesem Kongressvortrag (Nur abstract in dem Band enthalten) habe ich zwei Folien gezeigt, die ich mal hier einfüge:
Die Abb. zeigt, dass in einem Aufzuchtversuch, Brut aus einem gemischten Nest, aber nur von M. rubra-Arbeiterinnen aufgezogen, viele junge Gynen in der Größe intermediär zwischen rubra und microrubra waren. – Bei Sozialparasiten ist mir so etwas noch nie begegnet.
Die Tabelle enthält Daten zur Ovariolenzahl, zum Geschlechterverhältnis und zur Chromosomenzahl bei rubra resp. microrubra. Die Karyotypen müssten dringend mit mehr Material untersucht werden!
Schließlich erinnere ich mich noch an eine Beobachtung bei der Suche nach microrubra: Bei Störung von Nestern (in Totholz, an einem warmen Apriltag) stürmten neben rubra-Arbeiterinnen auch zahlreiche microrubra-Gynen heraus und schienen das Nest verteidigen zu wollen. (Sie stechen übrigens fühlbar!) – Aber für einen Sozialparasiten wäre es ja ein merkwürdiges Verhalten, wenn überwinterte begattete und unbegattete Gynen, statt sich im Nest zu verbergen, zur Nestverteidigung antreten würden!
Ich habe mich immer nur „nebenher“ mit den microrubra befasst, zum einen wegen der Ungewissheit, ob man sie überhaupt findet, zum anderen wegen der m. E. sehr ungewöhnlichen Befunde. Habe es daher auch nie gewagt, einen Kandidaten auf diese Sache anzusetzen….
Und natürlich gab es jede Menge andere Sozialparasiten-Themen.
Jedenfalls ist es meine Meinung, dass das Problem längst noch nicht gelöst ist, und dass eine Etikettierung der microrubra als „Sozialparasiten“ (in der „engeren Fassung“ des Begriffs) oder gar als „intraspezifische Sozialparasiten“ die Besonderheiten des Falles eher verschleiert als einer Lösung näher bringt! Nix für Ungut!
MfG,
Merkur
Zur Definitionsfrage:
- Das Buch kenne ich in der Tat nicht. Würde darin aber auch keine Definition für (intraspezifischen) Sozialparasitismus erwarten. Aber meine Kritik richtet sich ja ganz allgemein gegen die unterschiedlichen Definitionen für ein- und denselben Begriff. Wie gesagt: Jeder hat das Recht, Fachbegriffe nach eigenem Geschmack und Bedarf zu deuten. Für Klarheit sorgt das leider nicht.Die von uns verwendete Definition von (intraspezifischem) Sozialparasitismus ist nicht neu, sondern geht auf die Referenz: Nash D. R. & Boomsma J. J. 2008. Communication between hosts and Social Parasites. In Sociobiology of Communication: an Interdisciplinary Perspective (P. d’Ettorre & D. Hughes, eds.), chap. 4, pp 55-79. Oxford University Press, London. 346 p. zurück, welche an entsprechender Stelle zitiert wurde.

Es wird in der Folge erklärt! > „… scheint auch [i]M. microrubra ausgesprochen selten, zerstreut und lokal eng begrenzt auf kleinste Räume vorzukommen, dies aber obwohl ihre Wirtsart M. rubra eine der häufigsten und in dichten Populationen weitestverbreiteten Ameisen Mitteleuropas ist!“<[/i] Das ist wohl ungeschickt ausgedrückt: Die microrubra-Vorkommen sind oft innerhalb großer, dichter Wirtspopulationen, ohne sich darin auszubreiten. - Für mich „störend“ ist ferner der Eindruck, dass „microrubra“ an einigen Stellen, die ich kenne und gelegentlich besuche, mal leicht zu finden ist, dann wieder über Jahre „fehlt“, und evtl. dann wieder da ist. – Bei den sonst von mir untersuchten (vielen!) Sozialparasiten kann ich mich darauf verlassen, dass ich an einem Fundort jederzeit wieder neues Material holen kann (falls nicht das Habitat gründlich verändert wurde).Demgegenüber erstaunt besonders das Verbreitungsbild von M. microrubra im Vergleich zu anderen, sicheren Inquilinen. Solche finden sich nach allen Erfahrungen des Verfassers fast immer nur in Bereichen mit genügend hoher Populationsdichte ihrer Wirtsart. Dazwischenliegende Populationen der Selbständigen Art mit geringerer Dichte sind frei von den Parasiten….
– Und natürlich konnte der Beitrag nur meinen Kenntnisstand von 1997 wiedergeben, vor 17 Jahren. Ist aber im wesentlichen so geblieben…
Ich gebe zu bedenken, dass durch eine „Krankheit“ im weitesten Sinn betroffene Individuen durchaus für „gesunde“ Koloniemitglieder eine Belastung sein können. Ob man solche Individuen/-gruppen als Parasiten auffasst, ist wiederum eine Angelegenheit der Interpretation resp. Definition. Mit „Erkrankung“ meine ich sowohl Genetische „Entgleisungen“, als auch durch Endoparasiten, Bakterien, Viren etc. ausgelöste verringerte Fitness, die hier durch Leistungen der „Wirte“ ausgeglichen werden kann. Nach Wolbachia hat wohl noch niemand bei microrubra gesucht? Es gibt Viren, die bei Waldameisen für die Entstehung der „Pseudogynen“ = „Sekretergaten“ verantwortlich gemacht werden. Gibt es andere, bisher unbekannte Erreger? – Wir wissen viel zu wenig darüber!Die Anwesenheit von entflügelten Mikrogynen hat die betroffenen, mit Makrogynen gemischten Nester geschwächt. Die Mikrogynen lebten also auf Kosten dieser nicht mit ihnen verwandten Makrogynen-Völker (was sie zu Parasiten macht)…

Meine Vermutung geht in Richtung einer Störung in der Morphendetermination (Nicht: Kastendetermination! Kasten definiere ich nach der Funktion).
U. a. haben wir auch den Karyotyp bei rubra und microrubra verglichen; er ist identisch, s.u..
Ein Verdacht war, dass rubra ehemals eine Chromosomenzahl-Verdopplung durchgemacht haben könnte, und dass microrubra ein Atavismus, ein „Rückfall“ auf die ursprüngliche Chromosomenzahl, sein könnte.
Was mir in meinem Material auffiel, war auch ein merklicher Polymorphismus unter den Mikrogynen: Manche waren sehr klein und sogar intermorph (zwischen Arbeiterin und Gyne), gelegentlich mit nur einem Flügelpaar und reduziertem Thorax-Skelett. Auch das nicht seltene Auftreten von (scheinbar) normalen Arbeiterinnen mit drei voll entwickelten Ocellen gibt mir zu denken; siehe:„Was die reinen Mikrogynen-Kolonien angeht haben wir darauf hingewiesen dass zu unserer Überraschung einige dieser Nester in Abwesenheit von Wirten normale Mengen von Arbeiterinnen produziert haben.“
viewtopic.php?f=50&t=79&p=5235#p5235
Buschinger,A. (1997): Ist Myrmica microrubra eine sozialparasitische Ameise? in: Soziale Insekten, IUSSI-Tagung Graz 1997, p. 25, K. Crailsheim & A. Stabentheiner (Hrsg.):
In diesem Kongressvortrag (Nur abstract in dem Band enthalten) habe ich zwei Folien gezeigt, die ich mal hier einfüge:
Die Abb. zeigt, dass in einem Aufzuchtversuch, Brut aus einem gemischten Nest, aber nur von M. rubra-Arbeiterinnen aufgezogen, viele junge Gynen in der Größe intermediär zwischen rubra und microrubra waren. – Bei Sozialparasiten ist mir so etwas noch nie begegnet.

Die Tabelle enthält Daten zur Ovariolenzahl, zum Geschlechterverhältnis und zur Chromosomenzahl bei rubra resp. microrubra. Die Karyotypen müssten dringend mit mehr Material untersucht werden!
Schließlich erinnere ich mich noch an eine Beobachtung bei der Suche nach microrubra: Bei Störung von Nestern (in Totholz, an einem warmen Apriltag) stürmten neben rubra-Arbeiterinnen auch zahlreiche microrubra-Gynen heraus und schienen das Nest verteidigen zu wollen. (Sie stechen übrigens fühlbar!) – Aber für einen Sozialparasiten wäre es ja ein merkwürdiges Verhalten, wenn überwinterte begattete und unbegattete Gynen, statt sich im Nest zu verbergen, zur Nestverteidigung antreten würden!

Ich habe mich immer nur „nebenher“ mit den microrubra befasst, zum einen wegen der Ungewissheit, ob man sie überhaupt findet, zum anderen wegen der m. E. sehr ungewöhnlichen Befunde. Habe es daher auch nie gewagt, einen Kandidaten auf diese Sache anzusetzen….
Und natürlich gab es jede Menge andere Sozialparasiten-Themen.

Jedenfalls ist es meine Meinung, dass das Problem längst noch nicht gelöst ist, und dass eine Etikettierung der microrubra als „Sozialparasiten“ (in der „engeren Fassung“ des Begriffs) oder gar als „intraspezifische Sozialparasiten“ die Besonderheiten des Falles eher verschleiert als einer Lösung näher bringt! Nix für Ungut!

MfG,
Merkur
- 2
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Two articles to read!
Hallo Merkur,
Dass es zu einer “Etikettierung” der Myrmica rubra-Mikrogyne kommt glaube ich nicht. Eher dass verschiedene Autoren (uns eingeschlossen) aufgrund verschiedener Methoden zum Schluss gekommen sind dass es sich bei “M. microrubra” um eine intermediäre Form zwischen einer harmlosen kleinen Königinnenmorphe (wie z. B. bei M. ruginodis) und einer echten, mikrogynenartigen Inquilinenart (wie z. B. M. hirsuta) handelt - welche aber die entscheidende Eigenschaft eines Parasiten, nämlich die Virulenz, klar besitzt.
Bei so einer Übergangsform würde ich also nur erwarten dass es einiges gibt was (noch?) nicht zu einer echten Inquilinenart passt, sowie es eben auch einiges gibt das nicht zu einer harmlosen kleinen Königinnenmorphe passt.
Aber bei einem solch schwierigen Thema finde ich eine Vielfalt an Meinungen nur positiv! Man sei gespannt was die Zukunft bringt.
LG,
\S
Dass es zu einer “Etikettierung” der Myrmica rubra-Mikrogyne kommt glaube ich nicht. Eher dass verschiedene Autoren (uns eingeschlossen) aufgrund verschiedener Methoden zum Schluss gekommen sind dass es sich bei “M. microrubra” um eine intermediäre Form zwischen einer harmlosen kleinen Königinnenmorphe (wie z. B. bei M. ruginodis) und einer echten, mikrogynenartigen Inquilinenart (wie z. B. M. hirsuta) handelt - welche aber die entscheidende Eigenschaft eines Parasiten, nämlich die Virulenz, klar besitzt.
Bei so einer Übergangsform würde ich also nur erwarten dass es einiges gibt was (noch?) nicht zu einer echten Inquilinenart passt, sowie es eben auch einiges gibt das nicht zu einer harmlosen kleinen Königinnenmorphe passt.
Aber bei einem solch schwierigen Thema finde ich eine Vielfalt an Meinungen nur positiv! Man sei gespannt was die Zukunft bringt.

LG,
\S
- 2
- argus
- Mitglied
- Beiträge: 3
- Registriert: Mittwoch 19. November 2014, 22:19
- Bewertung: 11
18 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu Wissenschaft und Medien
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
