Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Die Erkenntnis dürfte zwar nicht so neu sein, aber in diesem Video sieht man sehr gut den Aufbau und die Arbeitsweise der Putzscharte.
Nanotechniker erhoffen sich hier etwas abschauen zu können, was die Reinigung von Oberflächen anbetrifft.
Nanotechniker erhoffen sich hier etwas abschauen zu können, was die Reinigung von Oberflächen anbetrifft.
- 2
Zuletzt geändert von Trailandstreet am Mittwoch 29. Juli 2015, 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
-

Trailandstreet - Mitglied
- Beiträge: 1174
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 21:02
- Wohnort: Ho'mbua
- Bewertung: 1693
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Der Standard berichtet über neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die manchem Ameisenhalter womöglich gar nicht so neu vorkommen 
Hier gehts zur Originalarbeit: http://www.nature.com/ncomms/2015/15072 ... s8729.html
Edit: Die Welt: http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/ ... erung.html

Hier gehts zur Originalarbeit: http://www.nature.com/ncomms/2015/15072 ... s8729.html
Edit: Die Welt: http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/ ... erung.html
- 3
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
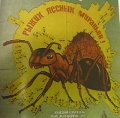
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Der Geruchssinn der Ameisen ist noch ausgeprägter als bisher gedacht: Sie können beinahe alle Arten von Kohlenwasserstoffen erkennen, die auf dem Außenskelett von Artgenossen zu finden sind. An diesem Bouquet können sie sowohl Tiere aus der eigenen als auch die aus einer fremden Kolonie erkennen.
http://www.spektrum.de/news/ameisen-hab ... nn/1360640
Geforscht wurde an der University of California an Camponotus floridanus.
Hiergehts zur Originalarbeit:
http://www.cell.com/cell-reports/abstra ... %2900791-3

Quelle: www.spektrum.de
- 2
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
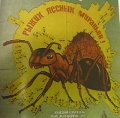
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
"Ameisen wissen, wann sie Medizin brauchen".
Der Standart berichtet über eine Experiment mit Formica fusca. Sie soll ihre Ernährungsgewohnheiten dem Gesundheitszustand anpassen können.
http://derstandard.at/2000021251599/Ame ... n-brauchen
Der Standart berichtet über eine Experiment mit Formica fusca. Sie soll ihre Ernährungsgewohnheiten dem Gesundheitszustand anpassen können.
Forscher der Universität Helsinki berichten im Fachblatt "Evolution", dass sie Grauschwarze Sklavenameisen (Formica fusca) dabei beobachtet haben, wie sie ihre Ernährungsgewohnheiten an ihre Gesundheit anpassten. Diese von Skandinavien bis in den Alpenraum verbreiteten Tiere, die zu den Waldameisen zählen, können vom pathogenen Pilz Beauveria bassiana infiziert werden. Geschieht dies, greifen die Ameisen verstärkt zu Nahrung, die Wasserstoffperoxid enthält.
http://derstandard.at/2000021251599/Ame ... n-brauchen
- 2
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
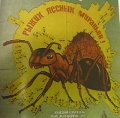
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Hallo Reber,
bin vor einigen Tagen auch schon mal auf das Thema gestoßen:
viewtopic.php?f=23&t=1096
Interessante Forschungen mit verblüffendem Ergebnis!
bin vor einigen Tagen auch schon mal auf das Thema gestoßen:
viewtopic.php?f=23&t=1096
Interessante Forschungen mit verblüffendem Ergebnis!
- 1
- Anon
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Hey,
mir ist das hier über den Weg gelaufen:
http://www.spektrum.de/news/die-meisten-ameisen-sind-faulpelze/1369866?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=heute
Faule Biester, sie müssten wissen, dass nur Vollbeschäftigung längerfristigen Erfolg garantiert!
Der Mensch ist wohl zu lang einem falschen Ideal gefolgt?!
Grüße
Krabbel
mir ist das hier über den Weg gelaufen:
http://www.spektrum.de/news/die-meisten-ameisen-sind-faulpelze/1369866?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=heute
Faule Biester, sie müssten wissen, dass nur Vollbeschäftigung längerfristigen Erfolg garantiert!
Der Mensch ist wohl zu lang einem falschen Ideal gefolgt?!
Grüße
Krabbel
- 2
Zeit spielt keine Rolle. Das einzige, was eine Rolle spielt, ist das Leben.
-

Krabbeltierfan - Moderator
- Beiträge: 144
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 13:06
- Bewertung: 223
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Hallo Krabbel,
Da ist das Spektrum wieder mal arg zu spät dran, und es wird genau das wiedergekaut, was andere Blätter auch schon daraus gemacht haben, siehe hier:
viewtopic.php?f=23&t=131&start=40#p8292
Dass solche "faulen Ameisen" im "Superorganismus Ameisenstaat" wichtige Stoffwechsel-, Verdauungs- und Synthese"organe" sein könnten, habe ich schon öfter postuliert.
Wir setzen bei den von außen sichtbaren Aktivitäten ja auch nicht direkt unsere Verdauungsorgane Darm und Leber etc. ein.
(Ein Vergleich mit einem scheinbar faul dasitzenden, dabei hoch produktiven Kopfarbeiter erübrigt sich, da es im Superorganismus Ameisenstaat kein Pendant gibt).
MfG,
Merkur
Da ist das Spektrum wieder mal arg zu spät dran, und es wird genau das wiedergekaut, was andere Blätter auch schon daraus gemacht haben, siehe hier:
viewtopic.php?f=23&t=131&start=40#p8292
Dass solche "faulen Ameisen" im "Superorganismus Ameisenstaat" wichtige Stoffwechsel-, Verdauungs- und Synthese"organe" sein könnten, habe ich schon öfter postuliert.
Wir setzen bei den von außen sichtbaren Aktivitäten ja auch nicht direkt unsere Verdauungsorgane Darm und Leber etc. ein.

(Ein Vergleich mit einem scheinbar faul dasitzenden, dabei hoch produktiven Kopfarbeiter erübrigt sich, da es im Superorganismus Ameisenstaat kein Pendant gibt).
MfG,
Merkur
- 3
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Die Süddeutsche Zeitung berichtet über Versuche von Wissenschaftlern der University of Bristol an Temnothorax albipennis.
Ameisen können demnach die Grösse und den Wirkungsort einer Gefahr einschätzen und dementsprechend reagieren. Das dürfte auch manchem Halter oder Beobachter schon aufgefallen sein
Hier gehts zur Arbeit: http://journals.plos.org/plosone/articl ... ne.0141012
Um dem Staat vorzugaukeln, dass Nestbewohner angegriffen und getötet wurden, entfernten die Forscher einzelne Ameisen von verschiedenen Stellen der Kolonie. Ließen sie Späherameisen verschwinden, die am Rande der Kolonie umherkrabbelten, zogen sich nach kurzer Zeit alle Tiere ins Innere des Nests zurück.
Entfernten die Forscher dagegen Ameisen aus dem Zentrum, löste das die höchste Alarmstufe aus. Die gesamte Kolonie floh und suchte sich anderswo eine neue Bleibe.
Ameisen können demnach die Grösse und den Wirkungsort einer Gefahr einschätzen und dementsprechend reagieren. Das dürfte auch manchem Halter oder Beobachter schon aufgefallen sein

Die Wissenschaftler sehen in diesem Verhalten Parallelen zur Reaktion von Tieren oder Menschen auf Verletzungen, die ebenfalls unterschiedlich ausfalle, je nachdem, welcher Teil des Körpers betroffen ist. Der Verlust von Ameisen aus der Peripherie der Kolonie entspreche dabei in etwa einer Situation, in der sich ein Mensch die Hand an einer heißen Herdplatte verbrennt.
Charakteristisch für einen Superorganismus ist, dass er Leistungen vollbringt, zu denen ein einzelnes seiner Mitglieder nie im Stande wäre und Lösungen für komplexe Probleme findet.
Hier gehts zur Arbeit: http://journals.plos.org/plosone/articl ... ne.0141012
- 4
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
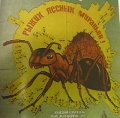
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
O’Shea-Wheller TA, Sendova-Franks AB, Franks NR (2015) Differentiated Anti-Predation Responses in a Superorganism. PLoS ONE 10(11): e0141012. doi:10.1371/journal.pone.0141012
Die Arbeit entstand im Labor von Prof. Nigel Franks in Bristol, UK. Die Versuchstiere, Temnothorax albipennis, werden von seiner Forschungsgruppe seit vielen Jahren für verschiedenste Versuchszwecke genutzt. Einige ihrer Arbeiten werden in den References zitiert. Es ist in England neben T. nylanderi die einzige gut zugängliche Temnothorax-Art.
Der Abschnitt „Materials and Methods“ enthält einige auch für Ameisenhalter interessante Bemerkungen:
Die Völkchen wurden im Januar gesammelt (wenn man komplette Kolonien aufsaugen kann; haben wir auch meistens so gemacht ).
).
Experimente wurden ab Ende Januar durchgeführt; auch das ist bei T. albipennis möglich, die Winterruhe kann verkürzt werden (zumindest, wenn man die Völker nicht überJahre halten will).
Sammelerlaubnis war nicht nötig. Die Völker stammten von einem öffentlich zugänglichen, stark gestörten Steinbruchsgelände; die Art ist nicht geschützt. Das Sammeln erfolgte nach einem Rotationsschema (nach Orten und Datum wohl über die Jahre) um die Population möglichst gering zu schädigen.
Die Haltung erfolgte in Plastik-Petrischalen mit Fluon als Ausbruchsschutz. Im Versuch wurden verschiedene rote Nestabdeckungen eingesetzt. Gefüttert wurde mit Drosophila melanogaster einmal pro Woche; Wasser und Honigwasser standen ständig zur Verfügung. Zu meiner Freude wird vermerkt, dass diese Fütterung der mit Bhatkar und Whitcomb-Diät vorgezogen wurde, da diese unbrauchbar sei für Arten, die von Wirbellosen als Beute und Honigtau leben; Zitat unserer Arbeit von 1988: Buschinger A, Pfeifer E.: Effects of nutrition on brood production and slavery in ants (Hymenoptera, Formicidae). Insectes Soc. 1988; 35: 61–69. doi: 10.1007/bf02224138
Die Arbeit wurde methodisch einwandfrei durchgeführt; die Ergebnisse hat Reber ja bereits zutreffend dargestellt: Es macht einen Unterschied, ob einzelne furagierende Arbeiterinnen außerhalb des Nestes abgefangen werden (“geringe Gefahr“, man zieht sich ins Nest zurück), oder ob man vorsichtig Tiere aus dem Nest selbst entfernt: Das entspricht einer ernsten Gefahr, das Volk zieht aus! – Auch diese Beobachtung mahnt zur Vorsicht bei der Entnahme von Ameisen aus Freilandnestern.
Alle Versuche wurden innerhalb von 10 Tagen durchgeführt. Ich denke, dass ein solcher Versuch bei uns z.B. auch mit Temnothorax nylanderi gelingen könnte. Das wäre dann ein Experiment, das auch als Schulversuch einsetzbar wäre, oder das man bei den in den Foren häufigen Fragen nach Vorschlägen für kleine Experimente im Rahmen von „Abschlussprüfungen“, Leistungskursen etc. empfehlen könnte.
MfG,
Merkur
Die Arbeit entstand im Labor von Prof. Nigel Franks in Bristol, UK. Die Versuchstiere, Temnothorax albipennis, werden von seiner Forschungsgruppe seit vielen Jahren für verschiedenste Versuchszwecke genutzt. Einige ihrer Arbeiten werden in den References zitiert. Es ist in England neben T. nylanderi die einzige gut zugängliche Temnothorax-Art.
Der Abschnitt „Materials and Methods“ enthält einige auch für Ameisenhalter interessante Bemerkungen:
Die Völkchen wurden im Januar gesammelt (wenn man komplette Kolonien aufsaugen kann; haben wir auch meistens so gemacht
 ).
).Experimente wurden ab Ende Januar durchgeführt; auch das ist bei T. albipennis möglich, die Winterruhe kann verkürzt werden (zumindest, wenn man die Völker nicht überJahre halten will).
Sammelerlaubnis war nicht nötig. Die Völker stammten von einem öffentlich zugänglichen, stark gestörten Steinbruchsgelände; die Art ist nicht geschützt. Das Sammeln erfolgte nach einem Rotationsschema (nach Orten und Datum wohl über die Jahre) um die Population möglichst gering zu schädigen.
Die Haltung erfolgte in Plastik-Petrischalen mit Fluon als Ausbruchsschutz. Im Versuch wurden verschiedene rote Nestabdeckungen eingesetzt. Gefüttert wurde mit Drosophila melanogaster einmal pro Woche; Wasser und Honigwasser standen ständig zur Verfügung. Zu meiner Freude wird vermerkt, dass diese Fütterung der mit Bhatkar und Whitcomb-Diät vorgezogen wurde, da diese unbrauchbar sei für Arten, die von Wirbellosen als Beute und Honigtau leben; Zitat unserer Arbeit von 1988: Buschinger A, Pfeifer E.: Effects of nutrition on brood production and slavery in ants (Hymenoptera, Formicidae). Insectes Soc. 1988; 35: 61–69. doi: 10.1007/bf02224138
Die Arbeit wurde methodisch einwandfrei durchgeführt; die Ergebnisse hat Reber ja bereits zutreffend dargestellt: Es macht einen Unterschied, ob einzelne furagierende Arbeiterinnen außerhalb des Nestes abgefangen werden (“geringe Gefahr“, man zieht sich ins Nest zurück), oder ob man vorsichtig Tiere aus dem Nest selbst entfernt: Das entspricht einer ernsten Gefahr, das Volk zieht aus! – Auch diese Beobachtung mahnt zur Vorsicht bei der Entnahme von Ameisen aus Freilandnestern.
Alle Versuche wurden innerhalb von 10 Tagen durchgeführt. Ich denke, dass ein solcher Versuch bei uns z.B. auch mit Temnothorax nylanderi gelingen könnte. Das wäre dann ein Experiment, das auch als Schulversuch einsetzbar wäre, oder das man bei den in den Foren häufigen Fragen nach Vorschlägen für kleine Experimente im Rahmen von „Abschlussprüfungen“, Leistungskursen etc. empfehlen könnte.
MfG,
Merkur
- 3
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Hier gehts zu einer Studie der Princeton University mit der Wanderameise Eciton hamatum über die "Denkweise" bzw. die kollektive "Entscheidungsweise" der Ameise beim Brückenbau.
Die Art ist in der Lage lebende Brücken aus ihren eigenen Körpern zu formen um das Fortkommen der Kolonie zu erleichtern und kleine Hindernisse zu überwinden. Dabei bemerkten die Forscher, dass die Kolonie den Brückenbau erst einstellt, sobald sie bemerken, dass die Brücke stabil genug ist. Aber auch dann, wenn sie bemerkt, dass der Bau zu viele Ameisen von anderen Arbeiten abhält.

Bild Quelle: Yahoo Nachrichten, dort wirt allerdings von der Gattung Solenopsis berichtet. Bei Gallileo TV findet man das Bild im Zusammenhang mit der erwähnten Studie über Eciton.
Die Art ist in der Lage lebende Brücken aus ihren eigenen Körpern zu formen um das Fortkommen der Kolonie zu erleichtern und kleine Hindernisse zu überwinden. Dabei bemerkten die Forscher, dass die Kolonie den Brückenbau erst einstellt, sobald sie bemerken, dass die Brücke stabil genug ist. Aber auch dann, wenn sie bemerkt, dass der Bau zu viele Ameisen von anderen Arbeiten abhält.

Bild Quelle: Yahoo Nachrichten, dort wirt allerdings von der Gattung Solenopsis berichtet. Bei Gallileo TV findet man das Bild im Zusammenhang mit der erwähnten Studie über Eciton.
- 6
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
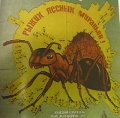
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Amerikanischen Biologen von der University of Pennsylvania ist es gelungen das typische Verhalten von Arbeiterinnen aus verschiedenen Unterkasten, durch das Verfüttern oder Injizieren von Wirkstoffen zu verändern. Die Untersuchung fand an Minor- und Major-Arbeiterinnen von Camponotus floridanus statt. Die deutschsprachigen Medien bezeichnet die Majors als Soldaten.
Hier gehts zum Artikel in der NZZ und in Wissenschaft aktuell
Hier gehts zur Originalarbeit.

© The lab of Shelley Berger, PhD, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania
Hier gehts zum Artikel in der NZZ und in Wissenschaft aktuell
Hier gehts zur Originalarbeit.

© The lab of Shelley Berger, PhD, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania
- 4
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
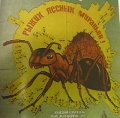
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
-

Trailandstreet - Mitglied
- Beiträge: 1174
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 21:02
- Wohnort: Ho'mbua
- Bewertung: 1693
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Ewig jung bleiben und dann trotzdem sterben? Pheidole dentata soll das Kunststück hinkriegen:
https://www.wired.de/collection/latest/ ... aupt-nicht
Hier gehts zur Arbeit:
http://rspb.royalsocietypublishing.org/ ... ticle-info
https://www.wired.de/collection/latest/ ... aupt-nicht
Hier gehts zur Arbeit:
http://rspb.royalsocietypublishing.org/ ... ticle-info
- 0
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
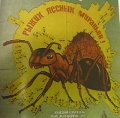
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Zum vorhergehenden Beitrag von Reber:
„Ameisen könnten der Schlüssel zu ewiger Jugend sein“, so der Titel des verlinkten Beitrags, und „Einige-ameisen-sind-uns-deutlich-voraus-sie-altern-ueberhaupt-nicht": https://www.wired.de/collection/latest/ ... aupt-nicht
Um Aufmerksamkeit zu erregen, muss man heutzutage nur einen Bezug zum Menschen herstellen, und sei er noch so bemüht an den spärlichen Haaren der Ameisen herbeigezogen!
Ein Großteil der menschlichen Gehirnzellen hat eine Lebenserwartung von 70 und mehr Jahren. Es ist eine Binsenweisheit, dass Ameisenköniginnen sehr viel länger leben als die Arbeiterinnen. Entsprechend muss ihr Gehirn auch bis nahe an 30 Jahre funktionsfähig bleiben. Da wäre es sicher interessant, die Lebensdauer der Gehirnzellen solcher Königinnen heranzuziehen. Man muss dazu nicht 30Jahre warten, schon 2-3 Jahre alte Königinnen könnten relevante Ergebnisse liefern. Aber auch das dauert in der Zeit der “fast-food-science“ zu lange.
Interessant wäre vor allem der Vergleich älterer (fertiler) Königinnen mit unbegattet gebliebenen, denn die hohe Lebenserwartung gilt nur für solche, die begattet sind und sich fleißig der Fortpflanzung widmen. Unbegattet in der Rolle von Arbeiterinnen leben sie nicht länger als diese, wie wir selbst in vielen Laborversuchen gesehen haben.
Hier gibt es den kompletten Text der verlinkten Arbeit:
https://www.researchgate.net/profile/Ja ... 7291b1.pdf
Abstract:
Analyses of senescence in social species are important to understanding how
group living influences the evolution of ageing in society members. Social
insects exhibit remarkable lifespan polyphenisms and division of labour,
presenting excellent opportunities to test hypotheses concerning ageing and
behaviour. Senescence patterns in other taxa suggest that behavioural performance
in ageing workers would decrease in association with declining
brain functions. Using the ant Pheidole dentata as a model, we found that
120-day-old minor workers, having completed 86% of their laboratory lifespan,
showed no decrease in sensorimotor functions underscoring complex tasks
such as alloparenting and foraging. Collaterally, we found no age-associated
increases in apoptosis in functionally specialized brain compartments or
decreases in synaptic densities in the mushroom bodies, regions associated
with integrative processing. Furthermore, brain titres of serotonin and
dopamine—neuromodulators that could negatively impact behaviour through
age-related declines—increased in old workers. Unimpaired task performance
appears to be based on the maintenance of brain functions supporting olfaction
and motor coordination independent of age. Our study is the first to comprehensively
assess lifespan task performance and its neurobiological correlates
and identify constancy in behavioural performance and the absence of
significant age-related neural declines.
Es ist jedenfalls eine sehr gründliche und vielseitige Arbeit aus einer sehr großen Wissenschaftssparte, der Altersforschung!
Eine weitere Arbeit aus 2014, von zwei der Autoren: Ysabel Milton Giraldoand and James F. A. Traniello: Worker senescence and the sociobiology of aging in ants, Behavioral Ecology and Sociobiology 12/2014. http://link.springer.com/article/10.100 ... -4#/page-1
Abstract:
Senescence, the decline in physiological and behavioral function with increasing age, has been the focus of significant theoretical and empirical research in a broad array of animal taxa. Preeminent among invertebrate social models of aging are ants, a diverse and ecologically dominant clade of eusocial insects characterized by reproductive and sterile phenotypes. In this review, we critically examine selection for worker lifespan in ants and discuss the relationship between functional senescence, longevity, task performance, and colony fitness. We did not find strong or consistent support for the hypothesis that demographic senescence in ants is programmed, or its corollary prediction that workers that do not experience extrinsic mortality die at an age approximating their lifespan in nature. We present seven hypotheses concerning how selection could favor extended worker lifespan through its positive relationship to colony size and predict that large colony size, under some conditions, should confer multiple and significant fitness advantages. Fitness benefits derived from long worker lifespan could be mediated by increased resource acquisition, efficient division of labor, accuracy of collective decision-making, enhanced allomaternal care and colony defense, lower infection risk, and decreased energetic costs of workforce maintenance. We suggest future avenues of research to examine the evolution of worker lifespan and its relationship to colony fitness, and conclude that an innovative fusion of sociobiology, senescence theory, and mechanistic studies of aging can improve our understanding of the adaptive nature of worker lifespan in ants.
MfG,
Merkur
„Ameisen könnten der Schlüssel zu ewiger Jugend sein“, so der Titel des verlinkten Beitrags, und „Einige-ameisen-sind-uns-deutlich-voraus-sie-altern-ueberhaupt-nicht": https://www.wired.de/collection/latest/ ... aupt-nicht
Um Aufmerksamkeit zu erregen, muss man heutzutage nur einen Bezug zum Menschen herstellen, und sei er noch so bemüht an den spärlichen Haaren der Ameisen herbeigezogen!

Ein Großteil der menschlichen Gehirnzellen hat eine Lebenserwartung von 70 und mehr Jahren. Es ist eine Binsenweisheit, dass Ameisenköniginnen sehr viel länger leben als die Arbeiterinnen. Entsprechend muss ihr Gehirn auch bis nahe an 30 Jahre funktionsfähig bleiben. Da wäre es sicher interessant, die Lebensdauer der Gehirnzellen solcher Königinnen heranzuziehen. Man muss dazu nicht 30Jahre warten, schon 2-3 Jahre alte Königinnen könnten relevante Ergebnisse liefern. Aber auch das dauert in der Zeit der “fast-food-science“ zu lange.

Interessant wäre vor allem der Vergleich älterer (fertiler) Königinnen mit unbegattet gebliebenen, denn die hohe Lebenserwartung gilt nur für solche, die begattet sind und sich fleißig der Fortpflanzung widmen. Unbegattet in der Rolle von Arbeiterinnen leben sie nicht länger als diese, wie wir selbst in vielen Laborversuchen gesehen haben.
Hier gibt es den kompletten Text der verlinkten Arbeit:
https://www.researchgate.net/profile/Ja ... 7291b1.pdf
Abstract:
Analyses of senescence in social species are important to understanding how
group living influences the evolution of ageing in society members. Social
insects exhibit remarkable lifespan polyphenisms and division of labour,
presenting excellent opportunities to test hypotheses concerning ageing and
behaviour. Senescence patterns in other taxa suggest that behavioural performance
in ageing workers would decrease in association with declining
brain functions. Using the ant Pheidole dentata as a model, we found that
120-day-old minor workers, having completed 86% of their laboratory lifespan,
showed no decrease in sensorimotor functions underscoring complex tasks
such as alloparenting and foraging. Collaterally, we found no age-associated
increases in apoptosis in functionally specialized brain compartments or
decreases in synaptic densities in the mushroom bodies, regions associated
with integrative processing. Furthermore, brain titres of serotonin and
dopamine—neuromodulators that could negatively impact behaviour through
age-related declines—increased in old workers. Unimpaired task performance
appears to be based on the maintenance of brain functions supporting olfaction
and motor coordination independent of age. Our study is the first to comprehensively
assess lifespan task performance and its neurobiological correlates
and identify constancy in behavioural performance and the absence of
significant age-related neural declines.
Es ist jedenfalls eine sehr gründliche und vielseitige Arbeit aus einer sehr großen Wissenschaftssparte, der Altersforschung!
Eine weitere Arbeit aus 2014, von zwei der Autoren: Ysabel Milton Giraldoand and James F. A. Traniello: Worker senescence and the sociobiology of aging in ants, Behavioral Ecology and Sociobiology 12/2014. http://link.springer.com/article/10.100 ... -4#/page-1
Abstract:
Senescence, the decline in physiological and behavioral function with increasing age, has been the focus of significant theoretical and empirical research in a broad array of animal taxa. Preeminent among invertebrate social models of aging are ants, a diverse and ecologically dominant clade of eusocial insects characterized by reproductive and sterile phenotypes. In this review, we critically examine selection for worker lifespan in ants and discuss the relationship between functional senescence, longevity, task performance, and colony fitness. We did not find strong or consistent support for the hypothesis that demographic senescence in ants is programmed, or its corollary prediction that workers that do not experience extrinsic mortality die at an age approximating their lifespan in nature. We present seven hypotheses concerning how selection could favor extended worker lifespan through its positive relationship to colony size and predict that large colony size, under some conditions, should confer multiple and significant fitness advantages. Fitness benefits derived from long worker lifespan could be mediated by increased resource acquisition, efficient division of labor, accuracy of collective decision-making, enhanced allomaternal care and colony defense, lower infection risk, and decreased energetic costs of workforce maintenance. We suggest future avenues of research to examine the evolution of worker lifespan and its relationship to colony fitness, and conclude that an innovative fusion of sociobiology, senescence theory, and mechanistic studies of aging can improve our understanding of the adaptive nature of worker lifespan in ants.
MfG,
Merkur
- 0
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Neue Beziehung zwischen Ameisen und einer Schmetterlingsart
http://eusozial.de/viewtopic.php?f=28&t ... 122#p39122
Hier berichtet Alexander Strödel über eine in Peru neu entdeckte Beziehung zwischen einer Schmetterlingsart und mehreren Ameisenarten, darunter auch Paraponera clavata.
https://entomologytoday.org/2016/06/16/ ... d-in-peru/
MfG,
Merkur
Hier berichtet Alexander Strödel über eine in Peru neu entdeckte Beziehung zwischen einer Schmetterlingsart und mehreren Ameisenarten, darunter auch Paraponera clavata.
https://entomologytoday.org/2016/06/16/ ... d-in-peru/
MfG,
Merkur
- 4
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Ein neues Buch über Waldameisen
Phil hat im eusozial-Forum darüber berichtet, dass im August ein neues Buch über Waldameisen erscheinen wird: Wood Ant Ecology and Conservation (Waldameisen Ökologie und Schutz).
http://eusozial.de/viewtopic.php?f=28&t ... 8cb#p39151
https://www.amazon.com/Wood-Ant-Ecology ... e754fa0fb0
Mit US$ 94.99 ist es nicht gerade billig. Bei Amazon kann man ein paar Seiten ansehen und auch die beeindruckende Liste der Autoren finden (u. a. B. Seifert und D. Cherix, Vorwort von B. Hölldobler).
Waldameisen im engeren Sinne (die Hügel bauenden Formica s. str.) sind in gemäßigten bis kalten Bereichen der Nordhalbkugel weit verbreitet. Die uns geläufigen Untergattungen Serviformica, Raptiformica und Coptoformica werden laut Antwiki derzeit als jüngere Synonyme von Formica aufgefasst. Das, obwohl es eine wahrscheinlich monophyletische „exsecta-group“ auch in Nordamerika gibt, ebenso wie ein paar Sklaven haltende Formica spp. mit der charakteristischen Kerbe im Clypeus wie bei unserer F. (R.) sanguinea. Das Buch soll sich jedoch nur mit der (ehemaligen) Untergattung Formica s. str. befassen, der "Formica rufa group".
MfG,
Merkur
Phil hat im eusozial-Forum darüber berichtet, dass im August ein neues Buch über Waldameisen erscheinen wird: Wood Ant Ecology and Conservation (Waldameisen Ökologie und Schutz).
http://eusozial.de/viewtopic.php?f=28&t ... 8cb#p39151
https://www.amazon.com/Wood-Ant-Ecology ... e754fa0fb0
Mit US$ 94.99 ist es nicht gerade billig. Bei Amazon kann man ein paar Seiten ansehen und auch die beeindruckende Liste der Autoren finden (u. a. B. Seifert und D. Cherix, Vorwort von B. Hölldobler).
Waldameisen im engeren Sinne (die Hügel bauenden Formica s. str.) sind in gemäßigten bis kalten Bereichen der Nordhalbkugel weit verbreitet. Die uns geläufigen Untergattungen Serviformica, Raptiformica und Coptoformica werden laut Antwiki derzeit als jüngere Synonyme von Formica aufgefasst. Das, obwohl es eine wahrscheinlich monophyletische „exsecta-group“ auch in Nordamerika gibt, ebenso wie ein paar Sklaven haltende Formica spp. mit der charakteristischen Kerbe im Clypeus wie bei unserer F. (R.) sanguinea. Das Buch soll sich jedoch nur mit der (ehemaligen) Untergattung Formica s. str. befassen, der "Formica rufa group".
MfG,
Merkur
- 4
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Leptothorax acervorum ist nicht gleich Leptothorax acervorum
Eine neue Arbeit zeigt eindrücklich, dass zwischen Populationen derselben Art, hier aus Spanien bzw. mitteleuropäischen Bereichen, gravierende Unterschiede in Verhalten, Sozialstruktur und Genetik bestehen können. Dies dürfte für viele weiter verbreitete und auch im Handel erhältliche Arten so sein.
Die Schmalbrustameise Leptothorax acervorum ist in gemäßigten bis alpinen und subarktischen Bereichen Eurasiens verbreitet. Manche Populationen sind fakultativ polygyn (Kolonien enthalten eine oder mehrere gleichartig fertile Königinnen), oder funktionell monogyn (im Nest können mehrere begattete Gynen leben, von denen jedoch nur eine dominant ist und reproduziert). Dieser „soziale Polymorphismus“ ist geografisch unterschiedlich verbreitet. So kommt funktionelle Monogynie im Inneren Spaniens vor, während fakultative Polygynie für die Populationen der Pyrenäen und des übrigen Europa typisch ist. Die Verfasser der neuen Arbeit haben die Situation mit molekulargenetischen Methoden analysiert. Sie konnten zeigen, dass die Populationen nicht reproduktiv isoliert sind, dass jedoch der Genfluss zwischen den Populationen eingeschränkt ist, so dass eine deutliche genetische Variation erkennbar wird. Dies wird auf klimatische, ökologische und historische Faktoren zurückgeführt: Klimaschwankungen im Quartär führten zur Bildung von isolierten Refugien (z. B. während der Eiszeiten), aus denen sich die heutigen Populationen entwickelt haben.
- Für mich spannend ist, dass es nun wohl definitiv in den spanischen Populationen keine Sozialparasiten gibt. In den Alpen und weiten Teilen Mittel- und Nordeuropas leben drei Arten arbeiterinloser Parasiten (Leptothorax goesswaldi, L. kutteri, L. pacis) und der Sklavenhalter Harpagoxenus sublaevis bei den fakultativ polygynen Populationen von L. acervorum.
Trettin J, Agrawal S, Heinze J (2016) Phylogeography of social polymorphism in a boreo-montane ant. - BMC Evolutionary Biology 16:137, 14p.
https://bmcevolbiol.biomedcentral.com/a ... 016-0711-3 (Download frei!)
Abstract
Background: The disjunct distribution of several Palearctic species has been widely shaped by the changes in climatic conditions during the Quaternary. The observed genetic differentiation or reproductive isolation between extant populations may be the outcome of their contemporary geographic separation or reproductive incompatibility due to differences in phenotypic traits which have evolved in isolated refugia. In the boreal ant Leptothorax acervorum, colonies from central and peripheral populations differ in social structure: colonies from Central and Northern Europe may contain several equally reproductive queens (facultative polygyny), while in colonies from peripheral populations in Spain only one the most dominant of several queens lays eggs (functional monogyny). By reconstructing the specie’s evolutionary and demographic history in Southwestern Europe we examine whether variation in social organization is associated with restricted gene flow between the two social
forms.
Results: We show that multi-queen colonies from all so far known inner Iberian populations of L. acervorum are functionally monogynous, whereas multi-queen colonies from all Pyrenean populations are polygynous, like those from other previously studied areas in Europe. Our analyses revealed complex spatial-genetic structure, but no association between spatial-genetic structure and social organization in SW-Europe. The population in the western
Pyrenees diverged most strongly from other Iberian populations. Moreover, microsatellite data suggest the occurrence of recent bottlenecks in Pyrenean and inner Iberian populations.
Conclusions: Our study shows a lack of reproductive isolation between the two social forms in SW-Europe. This in turn suggests that demographic and spatial patterns in genetic variation as well as the distribution of social phenotypes are better explained by co-variation with climatic, ecological, and historical factors.
Moreover, we for the first time show the existence of substantial spatial-genetic structure in L. acervorum, suggesting the existence of multiple refugia in SW-Europe, including two extra-Mediterranean refugia in France. While gene flow among inner Iberian refugia may have been larger during the late glacial, extra-Mediterranean refugia in southern France may have contributed to the post-glacial recolonization of W-Europe.
Keywords: Bottlenecks, Extra-Mediterranean refugia, Gene flow, Leptothorax acervorum, Phylogeography, Plastic behaviour, Population structure, Quaternary climate change, Reproductive skew
MfG,
Merkur
Eine neue Arbeit zeigt eindrücklich, dass zwischen Populationen derselben Art, hier aus Spanien bzw. mitteleuropäischen Bereichen, gravierende Unterschiede in Verhalten, Sozialstruktur und Genetik bestehen können. Dies dürfte für viele weiter verbreitete und auch im Handel erhältliche Arten so sein.
Die Schmalbrustameise Leptothorax acervorum ist in gemäßigten bis alpinen und subarktischen Bereichen Eurasiens verbreitet. Manche Populationen sind fakultativ polygyn (Kolonien enthalten eine oder mehrere gleichartig fertile Königinnen), oder funktionell monogyn (im Nest können mehrere begattete Gynen leben, von denen jedoch nur eine dominant ist und reproduziert). Dieser „soziale Polymorphismus“ ist geografisch unterschiedlich verbreitet. So kommt funktionelle Monogynie im Inneren Spaniens vor, während fakultative Polygynie für die Populationen der Pyrenäen und des übrigen Europa typisch ist. Die Verfasser der neuen Arbeit haben die Situation mit molekulargenetischen Methoden analysiert. Sie konnten zeigen, dass die Populationen nicht reproduktiv isoliert sind, dass jedoch der Genfluss zwischen den Populationen eingeschränkt ist, so dass eine deutliche genetische Variation erkennbar wird. Dies wird auf klimatische, ökologische und historische Faktoren zurückgeführt: Klimaschwankungen im Quartär führten zur Bildung von isolierten Refugien (z. B. während der Eiszeiten), aus denen sich die heutigen Populationen entwickelt haben.
- Für mich spannend ist, dass es nun wohl definitiv in den spanischen Populationen keine Sozialparasiten gibt. In den Alpen und weiten Teilen Mittel- und Nordeuropas leben drei Arten arbeiterinloser Parasiten (Leptothorax goesswaldi, L. kutteri, L. pacis) und der Sklavenhalter Harpagoxenus sublaevis bei den fakultativ polygynen Populationen von L. acervorum.
Trettin J, Agrawal S, Heinze J (2016) Phylogeography of social polymorphism in a boreo-montane ant. - BMC Evolutionary Biology 16:137, 14p.
https://bmcevolbiol.biomedcentral.com/a ... 016-0711-3 (Download frei!)
Abstract
Background: The disjunct distribution of several Palearctic species has been widely shaped by the changes in climatic conditions during the Quaternary. The observed genetic differentiation or reproductive isolation between extant populations may be the outcome of their contemporary geographic separation or reproductive incompatibility due to differences in phenotypic traits which have evolved in isolated refugia. In the boreal ant Leptothorax acervorum, colonies from central and peripheral populations differ in social structure: colonies from Central and Northern Europe may contain several equally reproductive queens (facultative polygyny), while in colonies from peripheral populations in Spain only one the most dominant of several queens lays eggs (functional monogyny). By reconstructing the specie’s evolutionary and demographic history in Southwestern Europe we examine whether variation in social organization is associated with restricted gene flow between the two social
forms.
Results: We show that multi-queen colonies from all so far known inner Iberian populations of L. acervorum are functionally monogynous, whereas multi-queen colonies from all Pyrenean populations are polygynous, like those from other previously studied areas in Europe. Our analyses revealed complex spatial-genetic structure, but no association between spatial-genetic structure and social organization in SW-Europe. The population in the western
Pyrenees diverged most strongly from other Iberian populations. Moreover, microsatellite data suggest the occurrence of recent bottlenecks in Pyrenean and inner Iberian populations.
Conclusions: Our study shows a lack of reproductive isolation between the two social forms in SW-Europe. This in turn suggests that demographic and spatial patterns in genetic variation as well as the distribution of social phenotypes are better explained by co-variation with climatic, ecological, and historical factors.
Moreover, we for the first time show the existence of substantial spatial-genetic structure in L. acervorum, suggesting the existence of multiple refugia in SW-Europe, including two extra-Mediterranean refugia in France. While gene flow among inner Iberian refugia may have been larger during the late glacial, extra-Mediterranean refugia in southern France may have contributed to the post-glacial recolonization of W-Europe.
Keywords: Bottlenecks, Extra-Mediterranean refugia, Gene flow, Leptothorax acervorum, Phylogeography, Plastic behaviour, Population structure, Quaternary climate change, Reproductive skew
MfG,
Merkur
- 0
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Zwei weitere westpaläarktische Lasius-Arten aus der Lasius alienus -Gruppe
Seifert, B. & Galkowski, C.(2016): The Westpalaearctic Lasius paralienus complex (Hymenoptera: Formicidae) contains three species. - Zootaxa 4132 (1): 044–058 http://www.mapress.com/j/zt/article/vie ... a.4132.1.4 !Bilder!
Abstract
Application of Numeric Morphology-Based Alpha-Taxonomy (NUMOBAT) demonstrated the existence of three cryptic species within the Westpalaearctic Lasius paralienus species complex: L. paralienus Seifert, 1992, having a wider European distribution north to Sweden, L. casevitzi sp. nov., an endemic of Corsica, and Lasius bombycina sp. nov. from southeast Central Europe, the Balkans and Asia Minor. Hierarchical NC-Ward clustering and non-hierarchical NC-k-means clustering of 16 morphological characters resulted in 98.7% identical classifications within 76 examined nest samples of the three species. The classification error in 180 worker individuals was 0% in a linear discriminant analysis (LDA) and 1.3% in a LOOCV-LDA. Differential characters to other species groups and an identification key of the six European members of the Lasius alienus Förster species group are provided.
Key words: numeric morphology-based alpha-taxonomy, nest centroid clustering, sister species, endemic, morphometry.
Lasius alienus wird merkwürdigerweise bei den Bestimmungen von “Lasius niger” – Jungköniginnen bzw. Völkern nie erwähnt, auch nicht im Handel angeboten, ebenso wenig wie L. paralienus. Nun kommen zwei weitere Arten hinzu, die man alle recht leicht mit L. niger verwechseln kann (wenn man Tiere aus den entsprechenden Verbreitungsgebieten erhält bzw. sammelt). Zumindest was man früher (vor den Arbeiten von Seifert) als „L. alienus“ bestimmt hat, ist gar nicht so selten. Bei der Bestimmung mit Dr. Seiferts Techniken werden allerdings die meisten an ihre Grenzen stoßen; auch ich!
MfG,
Merkur
Seifert, B. & Galkowski, C.(2016): The Westpalaearctic Lasius paralienus complex (Hymenoptera: Formicidae) contains three species. - Zootaxa 4132 (1): 044–058 http://www.mapress.com/j/zt/article/vie ... a.4132.1.4 !Bilder!
Abstract
Application of Numeric Morphology-Based Alpha-Taxonomy (NUMOBAT) demonstrated the existence of three cryptic species within the Westpalaearctic Lasius paralienus species complex: L. paralienus Seifert, 1992, having a wider European distribution north to Sweden, L. casevitzi sp. nov., an endemic of Corsica, and Lasius bombycina sp. nov. from southeast Central Europe, the Balkans and Asia Minor. Hierarchical NC-Ward clustering and non-hierarchical NC-k-means clustering of 16 morphological characters resulted in 98.7% identical classifications within 76 examined nest samples of the three species. The classification error in 180 worker individuals was 0% in a linear discriminant analysis (LDA) and 1.3% in a LOOCV-LDA. Differential characters to other species groups and an identification key of the six European members of the Lasius alienus Förster species group are provided.
Key words: numeric morphology-based alpha-taxonomy, nest centroid clustering, sister species, endemic, morphometry.
Lasius alienus wird merkwürdigerweise bei den Bestimmungen von “Lasius niger” – Jungköniginnen bzw. Völkern nie erwähnt, auch nicht im Handel angeboten, ebenso wenig wie L. paralienus. Nun kommen zwei weitere Arten hinzu, die man alle recht leicht mit L. niger verwechseln kann (wenn man Tiere aus den entsprechenden Verbreitungsgebieten erhält bzw. sammelt). Zumindest was man früher (vor den Arbeiten von Seifert) als „L. alienus“ bestimmt hat, ist gar nicht so selten. Bei der Bestimmung mit Dr. Seiferts Techniken werden allerdings die meisten an ihre Grenzen stoßen; auch ich!

MfG,
Merkur
- 0
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Ameisen mit "verbundenen" Augen
Um dies nachzuweisen, verschlossen die Wissenschaftler die Augen einiger Ameisen mit winzigen Augenklappen. "Während diese Insekten unter dem Körper des Nestgenossen reisten, konnten sie also weder Informationen für ihren Schrittzähler noch Bewegtbilder abspeichern. Und siehe da: Einmal vom Träger getrennt, waren die Ameisen auf dem Heimweg völlig orientierungslos", berichtet Wittlinger. Seine Kollegin Sarah Pfeffer resümiert: "Offenbar ist der optische Fluss eine eigenständige Orientierungshilfe, welche die Ameisen nutzen können – beispielsweise beim Getragenwerden". Dabei scheint es die getragenen Insekten nicht zu stören, dass sie Bewegtbilder in der Trageposition verkehrt herum wahrnehmen", so die Biologin.
http://www.wissenschaft.de/home/-/journ ... isen-Navi/
- 4
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
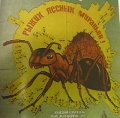
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Leichen von Polyergus rufescens bzw. Formica sanguinea und ihren Sklaven können unterschiedliche Verhaltensweisen bei den verschiedenen Arten auslösen:
I Maák, A Torma, J Kovács, A Somogyi, G Lőrinczi (2016): Threat, Signal or Waste? Meaning of Corpses in two Dulotic Ant Species. - Journal of Insect Behavior 29, 432-448.
Abstract
Ant corpses, besides representing threat of infection by pathogens and parasites, can also be used during interspecific conflicts to inhibit the activity of the attacked colony, or they can be consumed as food. In the view of the former, the signal properties of corpses can be manifold. Besides discriminating nestmates and foes, the corpses of different ant species may act as cues for foragers, signaling the presence of other rival species, and triggering appropriate responses (e.g., alarm, retreat or foraging). In our study, we examined the responses of the facultative slave-maker Formica sanguinea and those of the obligate Polyergus rufescens towards corpses of nestmates, non-nestmate conspecifics, heterospecific slave-makers and their slaves, and corpses of non-enslaved host species under laboratory conditions. Both dulotic species responded differently to corpses of different origin. In F. sanguinea, the most intensive response was elicited by the corpses of P. rufescens and its slave, but also the corpses of non-nestmate conspecifics and their slaves elicited many adverse responses. In P. rufescens, the corpses of non-nestmate conspecifics and their slaves elicited the most adverse response. Both dulotic species distinguished corpses of their slaves from corpses of non-enslaved hosts. Based on our results, ant corpses are not meaningless objects scattered in the field, but cues carrying information that trigger different behavioral responses, and in F. sanguinea they can even represent an important food source.
MfG,
Merkur
I Maák, A Torma, J Kovács, A Somogyi, G Lőrinczi (2016): Threat, Signal or Waste? Meaning of Corpses in two Dulotic Ant Species. - Journal of Insect Behavior 29, 432-448.
Abstract
Ant corpses, besides representing threat of infection by pathogens and parasites, can also be used during interspecific conflicts to inhibit the activity of the attacked colony, or they can be consumed as food. In the view of the former, the signal properties of corpses can be manifold. Besides discriminating nestmates and foes, the corpses of different ant species may act as cues for foragers, signaling the presence of other rival species, and triggering appropriate responses (e.g., alarm, retreat or foraging). In our study, we examined the responses of the facultative slave-maker Formica sanguinea and those of the obligate Polyergus rufescens towards corpses of nestmates, non-nestmate conspecifics, heterospecific slave-makers and their slaves, and corpses of non-enslaved host species under laboratory conditions. Both dulotic species responded differently to corpses of different origin. In F. sanguinea, the most intensive response was elicited by the corpses of P. rufescens and its slave, but also the corpses of non-nestmate conspecifics and their slaves elicited many adverse responses. In P. rufescens, the corpses of non-nestmate conspecifics and their slaves elicited the most adverse response. Both dulotic species distinguished corpses of their slaves from corpses of non-enslaved hosts. Based on our results, ant corpses are not meaningless objects scattered in the field, but cues carrying information that trigger different behavioral responses, and in F. sanguinea they can even represent an important food source.
MfG,
Merkur
- 2
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Zurück zu Wissenschaft und Medien
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
