Hinweise auf Ameisen in den Medien
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Zum Thema "Antibiotika bei Ameisen" hab ich im Net auch was gefunden. Wahrscheinlich kennt ihr das schon. Ich gebe den Link für Neulinge:
http://www.db-thueringen.de/servlets/De ... tation.pdf
http://www.db-thueringen.de/servlets/De ... tation.pdf
- 1
- LynnLectis
- Mitglied
- Beiträge: 262
- Registriert: Sonntag 12. April 2015, 21:22
- Bewertung: 387
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Es handelt sich um eine sehr umfangreiche Doktorarbeit hauptsächlich biochemischen Inhalts:
Ilka Schoenian (2011): Untersuchungen zur Vielfalt und Funktion von Antibiotika im Ökosystem der Blattschneiderameisen.
Dissertation Universität Jena 2011, 214 Seiten
Zusammenfassung S. 79 ff. (Leider sehr lang und mit komplizierten Formeln, daher nicht hier einkopiert!)
Publikation:
I. Schoenian, M. Spiteller, M Ghaste, R. Wirth, H. Herz, D. Spiteller (2011): Chemical basis of the synergism and antagonism in microbial communities in the nest of leaf-cutting ants. – Proc. Natl. Acad. Sci USA 108, p. 1955-1960.
Mal sehen, ob es irgendwo eine kürzere Fassung gibt.
MfG,
Merkur
Ilka Schoenian (2011): Untersuchungen zur Vielfalt und Funktion von Antibiotika im Ökosystem der Blattschneiderameisen.
Dissertation Universität Jena 2011, 214 Seiten
Zusammenfassung S. 79 ff. (Leider sehr lang und mit komplizierten Formeln, daher nicht hier einkopiert!)
Publikation:
I. Schoenian, M. Spiteller, M Ghaste, R. Wirth, H. Herz, D. Spiteller (2011): Chemical basis of the synergism and antagonism in microbial communities in the nest of leaf-cutting ants. – Proc. Natl. Acad. Sci USA 108, p. 1955-1960.
Mal sehen, ob es irgendwo eine kürzere Fassung gibt.

MfG,
Merkur
- 2
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Hallo Ameisenfreaks,
Heute habe ich mal im Google Play Store aus unerfindlichen Gründen nach dem Begriff "Ameisen" gesucht und staunte nicht schlecht!
Hätte nie gedacht eine solche Fülle von Apps und Büchern über Ameisen zu finden.
Aber seht selbst!
https://play.google.com/store/search?q=ameisen
Heute habe ich mal im Google Play Store aus unerfindlichen Gründen nach dem Begriff "Ameisen" gesucht und staunte nicht schlecht!
Hätte nie gedacht eine solche Fülle von Apps und Büchern über Ameisen zu finden.
Aber seht selbst!
https://play.google.com/store/search?q=ameisen
- 1
- hormigas
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
@ hormigas:
Seit Beginn der Ameisenforen gibt es immer mal wieder Hinweise auf Bücher und andere Literatur, z.B.:
http://ameisenwiki.de/index.php/Literaturempfehlungen
http://ameisenschutzwarte.de/forum/viewforum.php?f=27
http://www.ameisenforum.de/ameisenforum ... 21309.html
(Nur für angemeldete User)
Siehe auch hier: viewtopic.php?f=23&t=877
MfG,
Merkur
Seit Beginn der Ameisenforen gibt es immer mal wieder Hinweise auf Bücher und andere Literatur, z.B.:
http://ameisenwiki.de/index.php/Literaturempfehlungen
http://ameisenschutzwarte.de/forum/viewforum.php?f=27
http://www.ameisenforum.de/ameisenforum ... 21309.html
(Nur für angemeldete User)
Siehe auch hier: viewtopic.php?f=23&t=877
MfG,
Merkur
- 2
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Wie fühlt sich der Stich einer Paraponera an?
Alex Wild beschreibt einen Selbstversuch:
http://www.myrmecos.net/2015/07/11/what ... feel-like/
Bilder weiterer Versuchspersonen sind durchaus sehenswert:
http://www.alexanderwild.com/Profession ... /n-g8GZDr/
Viel Spaß!
Merkur
Alex Wild beschreibt einen Selbstversuch:
http://www.myrmecos.net/2015/07/11/what ... feel-like/
Bilder weiterer Versuchspersonen sind durchaus sehenswert:
http://www.alexanderwild.com/Profession ... /n-g8GZDr/

Viel Spaß!
Merkur
- 2
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Dazu passend
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmidt_Sting_Pain_Index
http://www.bbc.com/earth/story/20150312 ... sect-sting
http://www.compoundchem.com/wp-content/ ... -Index.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmidt_Sting_Pain_Index
http://www.bbc.com/earth/story/20150312 ... sect-sting
http://www.compoundchem.com/wp-content/ ... -Index.pdf
- 1
-

Trailandstreet - Mitglied
- Beiträge: 1174
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 21:02
- Wohnort: Ho'mbua
- Bewertung: 1693
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Die Süddeutsche Zeitung fragt nach dem Sinn der Faulheit bei Ameisen:
http://www.sueddeutsche.de/wissen/ameis ... -1.2570556
Die meisten tun mehr als die Hälfte der Zeit schlicht nichts, berichteten kürzlich Forscher um Anna Dornhaus von der University of Arizona im Fachblatt Behavioral Ecology and Sociobiology. Bestandteil der Studie sind entlarvende Videos. Sie zeigen, wie Arbeiterinnen fleißig Steinchen zu Mauern türmen und den Nachwuchs päppeln, während andere nahezu regungslos im Getümmel sitzen: wie bestellt und nicht abgeholt.
Für ihre Untersuchungen hatten die Forscher 281 Ameisen aus fünf verschiedenen Kolonien des Stammes Temnothorax rugatulus in einem Pinienwald des texanischen Santa-Catalina-Gebirges gesammelt, narkotisiert, unter dem Mikroskop mit verschiedenen Farben betupft und in Nestnachbauten gesetzt.
http://www.sueddeutsche.de/wissen/ameis ... -1.2570556
- 3
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
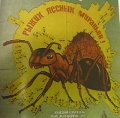
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Vielen Dank, Reber, für den Hinweis.
Hier ist ein Link zur Originalarbeit, allerdings ist nur das Abstract frei zugänglich.
http://link.springer.com/article/10.100 ... 015-1958-1
Und hier im New Scientist ist auch das Video zu sehen, mit hübsch bunten Ameisen.
https://www.newscientist.com/article/dn ... ates-work/
Die Frage nach der Bedeutung der „faulen“ Ameisen ist eigentlich uralt. Schließlich haben schon ziemlich viele Leute verschiedenen Ameisen im Kunstnest zugesehen und sich darüber Gedanken gemacht. Ich glaube die Lösung zu kennen.
Aber ich werde mich erst mal mit einem Kollegen besprechen, ob wir daraus nicht auch eine publikumswirksam aufgemachte Veröffentlichung zimmern sollen.
MfG,
Merkur
Hier ist ein Link zur Originalarbeit, allerdings ist nur das Abstract frei zugänglich.
http://link.springer.com/article/10.100 ... 015-1958-1
Und hier im New Scientist ist auch das Video zu sehen, mit hübsch bunten Ameisen.

https://www.newscientist.com/article/dn ... ates-work/
Die Frage nach der Bedeutung der „faulen“ Ameisen ist eigentlich uralt. Schließlich haben schon ziemlich viele Leute verschiedenen Ameisen im Kunstnest zugesehen und sich darüber Gedanken gemacht. Ich glaube die Lösung zu kennen.

Aber ich werde mich erst mal mit einem Kollegen besprechen, ob wir daraus nicht auch eine publikumswirksam aufgemachte Veröffentlichung zimmern sollen.

MfG,
Merkur
- 3
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Ich denke in der Natur macht das sicher Sinn, kurzfristig verfügbare Ressourcen zu haben, sei es durch plötzlichen Arbeitsanfall (Futter eintragen) oder Verteidigung des Nestes oder auch um den Ausfall einer größeren Anzahl von Arbeiterinnen abzufangen.
Das muss man halt mal nachstellen.
Das muss man halt mal nachstellen.
- 1
-

Trailandstreet - Mitglied
- Beiträge: 1174
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 21:02
- Wohnort: Ho'mbua
- Bewertung: 1693
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Temnothorax crassispinus unter "invasive Arten" abzubuchen, halte ich zwar für falsch. Ansonsten aber ein interessanter Artikel darüber, dass die kleinen Ameisen sich offenbar vom Wind übers Meer auf schwedische Inseln tragen liessen.
http://www.spektrum.de/news/fuer-ameise ... is/1361228
http://www.spektrum.de/news/fuer-ameise ... is/1361228
- 2
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
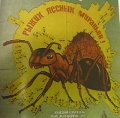
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Sollten sie über den Wind verfrachtet worden sein, wäre das eine ganz naürliche Verbreitung. Alle anderen invasiven Arten wurden ja mit Pflanzen und anderen Gütern durch den Menschen udn vor allem über weit größere Distanzen verschleppt.
Wenn dem aber so ist, müssten sie ja dort schon länger eine gewisse, mehr oder weniger stabile Population entwickelt haben, aber warum ist das nicht so? Sind die Grundlagen dort nicht so gut?
Wenn dem aber so ist, müssten sie ja dort schon länger eine gewisse, mehr oder weniger stabile Population entwickelt haben, aber warum ist das nicht so? Sind die Grundlagen dort nicht so gut?
- 1
-

Trailandstreet - Mitglied
- Beiträge: 1174
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 21:02
- Wohnort: Ho'mbua
- Bewertung: 1693
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Hier ist die Original-Pressemitteilung aus dem Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz:
18.08.2015 - Blowin' in the wind - Ameisen lassen sich über Ostsee pusten.
http://www.senckenberg.de/root/index.ph ... =2&id=3715
Veröffentlichung: Seifert, B. & Hagman, A.: Colonization overseas by long-range aerial drift in a Formicoxenine ant (Hymenoptera, Formicidae). [Luftspridning över havet av en liten ettermyra (Hymenoptera Formicidae).] – Entomologisk Tidskrift 136 (1-2): 5-15. Uppsala, Sweden 2015. ISSN 0013-886x.
Die Nachdichtung im „Spektrum“ hat wie üblich einige Schwächen.
Die „Heimat“ von T. crassispinus ist ja nicht nur Polen und Lettland. Die Art kommt auch im Osten Deutschlands vor, mit Grenze zur westlichen T. nylanderi etwa bei Leipzig, Freiberg, Ingolstadt, München.
Der Begriff „invasiv“ hat eine ziemliche Bandbreite von Interpretationen. In diesem Zusammenhang ist er definitiv falsch benutzt!
Erstaunlicher ist für mich seit langer Zeit das Vorkommen des Sklavenhalters Harpagoxenus sublaevis auf oft kleinen Schären vor Finnland, oder auch auf Öland: Die Art hat in Nordeuropa nur flügellose, ergatoide Königinnen (weiter südlich in D, Österreich, Schweiz und Norditalien kommen sehr selten geflügelte Gynen vor).
Dank der noch anhaltenden langsamen Hebung des Ostseegebiets nach der Eiszeit können die Inselpopulationen nicht Überbleibsel einer einst großflächig verbreiteten Population sein, die etwa durch Meeresspiegel-Anstieg nun auf Inseln lebt. Hier ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Verdriften mit Treibholz anzunehmen. H. sublaevis und seine Wirtsarten, vor allem Leptothorax acervorum, leben in Totholz, u. a. in der Borke umgestürzter toter Bäume., die auch mal ins Meer fallen und andernorts wieder angetrieben werden können.
MfG,
Merkur
18.08.2015 - Blowin' in the wind - Ameisen lassen sich über Ostsee pusten.
http://www.senckenberg.de/root/index.ph ... =2&id=3715
Veröffentlichung: Seifert, B. & Hagman, A.: Colonization overseas by long-range aerial drift in a Formicoxenine ant (Hymenoptera, Formicidae). [Luftspridning över havet av en liten ettermyra (Hymenoptera Formicidae).] – Entomologisk Tidskrift 136 (1-2): 5-15. Uppsala, Sweden 2015. ISSN 0013-886x.
Die Nachdichtung im „Spektrum“ hat wie üblich einige Schwächen.
Die „Heimat“ von T. crassispinus ist ja nicht nur Polen und Lettland. Die Art kommt auch im Osten Deutschlands vor, mit Grenze zur westlichen T. nylanderi etwa bei Leipzig, Freiberg, Ingolstadt, München.
Der Begriff „invasiv“ hat eine ziemliche Bandbreite von Interpretationen. In diesem Zusammenhang ist er definitiv falsch benutzt!
Erstaunlicher ist für mich seit langer Zeit das Vorkommen des Sklavenhalters Harpagoxenus sublaevis auf oft kleinen Schären vor Finnland, oder auch auf Öland: Die Art hat in Nordeuropa nur flügellose, ergatoide Königinnen (weiter südlich in D, Österreich, Schweiz und Norditalien kommen sehr selten geflügelte Gynen vor).
Dank der noch anhaltenden langsamen Hebung des Ostseegebiets nach der Eiszeit können die Inselpopulationen nicht Überbleibsel einer einst großflächig verbreiteten Population sein, die etwa durch Meeresspiegel-Anstieg nun auf Inseln lebt. Hier ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Verdriften mit Treibholz anzunehmen. H. sublaevis und seine Wirtsarten, vor allem Leptothorax acervorum, leben in Totholz, u. a. in der Borke umgestürzter toter Bäume., die auch mal ins Meer fallen und andernorts wieder angetrieben werden können.
MfG,
Merkur
- 4
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Kleine Änderungen in den Gen-Ablesenetzwerken bewerkstelligen offenbar die Beförderung von Arbeiterinnen zu Königinnen
Bei Wespen und Ameisen entwickeln sich Arbeiterinnen und Königinnen aus dem gleichen Erbgut. Stirbt eine Königin, kann eine Arbeiterin rasch in eine Königin transformiert werden: Eine kleine Umstellung im Ablesenetzwerk der DNA genügt, schreibt ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung im Fachblatt "PNAS". (http://derstandard.at/2000024147034/Wie ... ert-werden)
http://www.pnas.org/content/early/2015/10/14/1515937112
- 1
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
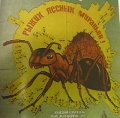
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Hallo Leute,
Ein Bericht von Charles Darwin (1859) über Blattläuse und Ameisen.
http://www.textlog.de/23749.html
Ich finde toll wie er die Tiere beobachtet und interpretiert
LG
hormigas
Ein Bericht von Charles Darwin (1859) über Blattläuse und Ameisen.
http://www.textlog.de/23749.html
Nun ist, wie es bei der Körperbildung der Fall und meiner Theorie gemäss ist, auch der Instinkt einer jeden Art nützlich für diese und soviel wir wissen niemals zum ausschließlichen Nutzen anderer Arten vorhanden. Eines der triftigsten Beispiele, die ich kenne, von Tieren, welche anscheinend zum bloßen Besten anderer etwas tun, liefern die Blattläuse, indem sie, wie HUBER Zuerst bemerkte, freiwillig den Ameisen ihre süssen Exkretionen überlassen.
Ich finde toll wie er die Tiere beobachtet und interpretiert

LG
hormigas
- 4
- hormigas
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Interessant erschien den Wissenschaftern vor allem, dass es, obwohl ausschließlich Arbeiterinnen, auch bei Cerapachys biroi zu einer Arbeitsteilung kommt: Brutpflege und Fortpflanzung. Sie können offenbar auch jederzeit switchen, durch eine sogenannte DNA-Methylierung, die Gene auch stilllegen kann. In einer aktuellen Studie, publiziert im Fachjournal "Current Biology" meldeten Forscher der Rockefeller University freilich erhebliche Zweifel an. Die Wissenschafter haben einen Durchschnittswert der DNA-Methylierung in den untersuchten Gruppen herausgefunden und schrieben in ihrer Arbeit, dass die Unterschiede nicht signifikant sind. Die genetische Basis für das Verhalten der sozialen Insekten ist demnach also doch nicht nachgewiesen. Die Unterschiede müssten dafür eindeutig größer sein. - derstandard.at/2000029598080/Verhalten-der-Ameisen-bleibt-ein-genetisches-Raetsel
http://derstandard.at/2000029598080/Ver ... es-Raetsel

Quelle: Der Standard / Rockefeller University / Daniel Kronauer
- 2
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
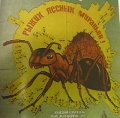
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Die relativ jungen Erkenntnisse zur DNA-Merthylierung in Verbindung mit dem „An- und Abschalten“ von Genen haben ja bereits eine sehr umfangreiche Literatur hervorgebracht.
Man kann sich ein Bild davon machen, wenn man die Originalarbeit aufruft: http://www.cell.com/current-biology/abs ... 60-9822(15)01571-7
Robust DNA Methylation in the Clonal Raider Ant Brain, von Romain Libbrecht, Laurent Keller, Peter Robert Oxley, Daniel Jan Christoph Kronauer.
Zwar ist hier nur das Abstract direkt zugänglich, nicht der volle Text, aber man kann auch das Literaturverzeichnis einsehen, wenn man auf der Seite die „References“ anklickt. Beeindruckend, und auch für mich im Einzelnen recht verwirrend!
Nun lassen Messungen der DNA-Merthylierung und deren Korrelation mit Kasten- bzw. Verhaltensmerkmalen noch keinen Schluss darauf zu, was Ursache und was Wirkung ist!
Auch für die unterschiedliche Methylierung der Erbsubstanz muss es Ursachen geben, Auslöser, die man dann letztlich als Erklärung für die beobachteten Phänomene heranziehen könnte!
Noch immer wird etwas schwammig bzw. zweideutig formuliert, wenn es um die „Königinnen“ geht: Meint man deren morphologische Unterschiede zu Arbeiterinnen, oder bezieht man sich auf ihre Funktion als die reproduzierenden Individuen in der Kolonie?
Die Autoren haben diese Problematik anscheinend bewusst umgangen (vielleicht steht es in dem mir noch nicht zugänglichen Text), indem sie eine Art ohne morphologische Kasten gewählt haben: Alle Individuen sind gleich gestaltet, und alle können prinzipiell Königinnen- oder Arbeiterinnenfunktion übernehmen.
Darüber hinaus ist Cerapachys biroi thelytok parthenogenetisch und clonal. Alle Individuen sind also genetisch identisch (evtl. unterschiedliche Väterkönnen keine Rolle spielen).
Dennoch fungieren einige der Tiere als Eierlegerinnen,(„Königinnen“, wenn man so will), andere bleiben steril („Arbeiterinen“), und anscheinend können sie die Funktion auch wechseln.
Wenn mit den beiden Funktionen nun eine unterschiedliche Methylierung der Erbsubstanz einher geht, kann diese die Ursache für die unterschiedliche Funktion sein, oder die Folge, oder es gibt einen weiteren Faktor, der für Beides verantwortlich ist.
Möglich wäre etwa ein unterschiedlicher Ernährungszustand infolge einer Hierarchie: Dominante Tiere bekommen von den dominierten Individuen Nähreier, die sie selbst in die Lage versetzen, eigene reproduktive Eier zu bilden. Auch hier stellt sich die Frage, ob die bessere Ernährung die Methylierung (im Gehirn) und damit das Dominanzverhalten bewirkt, oder ob die bessere Ernährung dasAnschalten bestimmter Gene triggert.
Möglicherweise spielt auch das Alter der Individuen eine Rolle: Von ganz „normalen“ Ameisen (Formica spp.)ist bekannt, dass junge Innendienst-Tiere zunächst entwickelte Ovarien haben und Nähreier für die Königinnen produzieren. Später degenerieren die Ovarien und die Tiere gehen zum Außendienst über. Aber: In weisellosen Völkchen vieler Arten können eine oder einige der noch jungen Arbeiterinnen „dominieren“, werden mit Nähreiern der anderen Arbeiterinnen gefüttert, und legen fertile Eier, aus denen sich Männchen entwickeln! (Ich nehme an, dass die Verfasser der Publikation diese Zusammenhänge kennen und berücksichtigt haben).
So gesehen behandelt diese Publikation eine "Zwischenstation" in der Erforschung der letztlichen Ursachen für die Entwicklung einer Larve zur Gyne oder Arbeiterin, UND der Ursachen für deren Verhaltensunterschiede.
MfG,
Merkur
Man kann sich ein Bild davon machen, wenn man die Originalarbeit aufruft: http://www.cell.com/current-biology/abs ... 60-9822(15)01571-7
Robust DNA Methylation in the Clonal Raider Ant Brain, von Romain Libbrecht, Laurent Keller, Peter Robert Oxley, Daniel Jan Christoph Kronauer.
Zwar ist hier nur das Abstract direkt zugänglich, nicht der volle Text, aber man kann auch das Literaturverzeichnis einsehen, wenn man auf der Seite die „References“ anklickt. Beeindruckend, und auch für mich im Einzelnen recht verwirrend!

Nun lassen Messungen der DNA-Merthylierung und deren Korrelation mit Kasten- bzw. Verhaltensmerkmalen noch keinen Schluss darauf zu, was Ursache und was Wirkung ist!
Auch für die unterschiedliche Methylierung der Erbsubstanz muss es Ursachen geben, Auslöser, die man dann letztlich als Erklärung für die beobachteten Phänomene heranziehen könnte!
Noch immer wird etwas schwammig bzw. zweideutig formuliert, wenn es um die „Königinnen“ geht: Meint man deren morphologische Unterschiede zu Arbeiterinnen, oder bezieht man sich auf ihre Funktion als die reproduzierenden Individuen in der Kolonie?
Die Autoren haben diese Problematik anscheinend bewusst umgangen (vielleicht steht es in dem mir noch nicht zugänglichen Text), indem sie eine Art ohne morphologische Kasten gewählt haben: Alle Individuen sind gleich gestaltet, und alle können prinzipiell Königinnen- oder Arbeiterinnenfunktion übernehmen.
Darüber hinaus ist Cerapachys biroi thelytok parthenogenetisch und clonal. Alle Individuen sind also genetisch identisch (evtl. unterschiedliche Väterkönnen keine Rolle spielen).
Dennoch fungieren einige der Tiere als Eierlegerinnen,(„Königinnen“, wenn man so will), andere bleiben steril („Arbeiterinen“), und anscheinend können sie die Funktion auch wechseln.
Wenn mit den beiden Funktionen nun eine unterschiedliche Methylierung der Erbsubstanz einher geht, kann diese die Ursache für die unterschiedliche Funktion sein, oder die Folge, oder es gibt einen weiteren Faktor, der für Beides verantwortlich ist.
Möglich wäre etwa ein unterschiedlicher Ernährungszustand infolge einer Hierarchie: Dominante Tiere bekommen von den dominierten Individuen Nähreier, die sie selbst in die Lage versetzen, eigene reproduktive Eier zu bilden. Auch hier stellt sich die Frage, ob die bessere Ernährung die Methylierung (im Gehirn) und damit das Dominanzverhalten bewirkt, oder ob die bessere Ernährung dasAnschalten bestimmter Gene triggert.
Möglicherweise spielt auch das Alter der Individuen eine Rolle: Von ganz „normalen“ Ameisen (Formica spp.)ist bekannt, dass junge Innendienst-Tiere zunächst entwickelte Ovarien haben und Nähreier für die Königinnen produzieren. Später degenerieren die Ovarien und die Tiere gehen zum Außendienst über. Aber: In weisellosen Völkchen vieler Arten können eine oder einige der noch jungen Arbeiterinnen „dominieren“, werden mit Nähreiern der anderen Arbeiterinnen gefüttert, und legen fertile Eier, aus denen sich Männchen entwickeln! (Ich nehme an, dass die Verfasser der Publikation diese Zusammenhänge kennen und berücksichtigt haben).
So gesehen behandelt diese Publikation eine "Zwischenstation" in der Erforschung der letztlichen Ursachen für die Entwicklung einer Larve zur Gyne oder Arbeiterin, UND der Ursachen für deren Verhaltensunterschiede.
MfG,
Merkur
- 1
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Kennt von euch jemand diese Internetseite:
http://www.ameisen-net.de
Oder bin ich der letzte der darüberstolpert
Wirklich eine liebevolle Bestandsaufnahme der Ameisen in Baden-Württemberg.
Beste Grüße
hormigas
http://www.ameisen-net.de
Oder bin ich der letzte der darüberstolpert

Wirklich eine liebevolle Bestandsaufnahme der Ameisen in Baden-Württemberg.
Beste Grüße
hormigas
- 2
- hormigas
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Hallo hormigas,
Die Seite kannte ich noch nicht, aber Christiana Klingenberg hat sich schon lange mit Automontage-Fotos von Ameisen befasst.
Sie ist mit dem Naturkundemuseum in Karlsruhe assoziiert, hat inzwischen allerdings wohl eine andere berufliche Ausrichtung.
http://www.smnk.de/en/research/entomolo ... enberg-57/
MfG,
Merkur
Die Seite kannte ich noch nicht, aber Christiana Klingenberg hat sich schon lange mit Automontage-Fotos von Ameisen befasst.
Sie ist mit dem Naturkundemuseum in Karlsruhe assoziiert, hat inzwischen allerdings wohl eine andere berufliche Ausrichtung.
http://www.smnk.de/en/research/entomolo ... enberg-57/
MfG,
Merkur
- 1
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
28 der 139 Ameisenarten der Schweiz kommen im Siedlungsgebiet, Wald und landwirtschaftlicher Umgebung in und bei Riehen vor, wie die Universität Basel am Mittwoch mitteilte. In Parkanlagen stiessen Forschende sogar auf gefährdete Arten wie die Untergrundameise Aphaenogaster subterranea, die auf der Roten Liste der Schweiz aufgeführt ist.
http://www.bauernzeitung.ch/sda-archiv/ ... ngsgebiet/
Amerikanische Forscher haben faszinierende neue Einblicke in das Leben der Atta cephalotes gewonnen, die in einem komplexen Staat und in enger Symbiose mit bestimmten Pilzen leben. Diese züchten sie als Nahrung auf einem Nährboden aus Blattstückchen.
Ryan Garrett von der University of Oregon und Kollegen fanden nun heraus, dass die Ameisen eine Strecke von drei Kilometern, und damit eine Million mal ihre eigene Körperlänge, schneiden müssen, um einen Quadratmeter Blätter zu zerlegen. Diese kräftezehrende Aufgabe erledigen sie so energiesparend wie möglich.
http://www.nzz.ch/wissenschaft/biologie ... 1.18683912
In der Versuchsanordnung im Labor stellten die Forscher fest, dass die Ameisen bevorzugt kleinere, vorperforierte Blattstücke aus dem Freien in ihrenunterirdischen Bau trugen und das Zerkleinern zu 90 Prozent erst im Bau erfolgte. Garrett und sein Team vermuten, dass dort vor allem junge Ameisen mit noch unbeschädigten Kiefern diese Arbeit erledigen – und so den Energieaufwand insgesamt möglichst gering halten.
http://www.tierwelt.ch/?rub=4495&id=42219
- 2
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
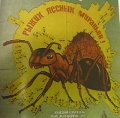
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Sendung im NDR: NaturNah: Die geheime Welt der Ameisen
Dienstag, 02. Februar 2016, 18:15 bis 18:45 Uhr
Mittwoch, 03. Februar 2016, 13:00 bis 13:30 Uhr
Ameisen breiten sich gern auf Terrasse oder Kinderspielplatz aus. Auch wenn sie auf der Liste der beliebtesten Tiere nicht im vorderen Bereich angesiedelt sind, gelten sie doch als die heimlichen Herrscher der Welt: Ameisen verbreiten Samen, vernichten Schädlinge und lockern den Boden auf, damit sich Pflanzen und Bäume ausbreiten können. Usw…
http://www.ndr.de/fernsehen/epg/import/ ... 76562.html
MfG,
Merkur
Dienstag, 02. Februar 2016, 18:15 bis 18:45 Uhr
Mittwoch, 03. Februar 2016, 13:00 bis 13:30 Uhr
Ameisen breiten sich gern auf Terrasse oder Kinderspielplatz aus. Auch wenn sie auf der Liste der beliebtesten Tiere nicht im vorderen Bereich angesiedelt sind, gelten sie doch als die heimlichen Herrscher der Welt: Ameisen verbreiten Samen, vernichten Schädlinge und lockern den Boden auf, damit sich Pflanzen und Bäume ausbreiten können. Usw…
http://www.ndr.de/fernsehen/epg/import/ ... 76562.html
MfG,
Merkur
- 3
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Zurück zu Wissenschaft und Medien
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
