Rätsel-Thread
Re: Rätsel-Thread
Eikokon einer Spinne; Marienkäfer hat sich darin verheddert und ist vertrocknet. ?
MfG,
Merkur
MfG,
Merkur
- 3
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Rätsel-Thread
Das Rätsel ist noch nicht aufgelöst.
Zu den bisherigen Lösungsversuchen: Der Marienkäfer kann nicht mehr fressen und es ist auch keine Spinne beteiligt.
Zu den bisherigen Lösungsversuchen: Der Marienkäfer kann nicht mehr fressen und es ist auch keine Spinne beteiligt.
- 3
-

MBM - Vereinsmitglied
- Beiträge: 155
- Registriert: Donnerstag 15. März 2018, 17:31
- Wohnort: Meißen
- Bewertung: 520
Re: Rätsel-Thread
Ok, dann wären wir wohl im Reich der Pilze und Parasiten! Wobei das Ding unter dem Marienkäfer eher nach Insekt, als nach Pilz ausschaut...
Und tatsächlich: Die Suchmaschine kennt eine Brackwespen-Larve, die Marienkäfer befällt: Dinocampus coccinellae?
Und tatsächlich: Die Suchmaschine kennt eine Brackwespen-Larve, die Marienkäfer befällt: Dinocampus coccinellae?
- 3
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
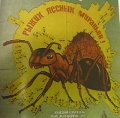
Reber - Moderator
- Beiträge: 1773
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3739
Re: Rätsel-Thread
Reber hat die Lösung!
Es sollte sich hier um den Kokon der Marienkäfer-Brackwespe (Dinocampus coccinellae) handeln. Deren Larve spinnt zum Schluss den ausgezehrten Marienkäfer, der ja bekanntlich von größeren Fressfeinden aus Erfahrung gemieden wird, über sich als eigenes Schutzschild mit ein. Deshalb sieht es so aus, als ob Pilzhyphen die Käferbeine überwuchern.
Die auf europäische Marienkäfer spezialisierte Wespe befalle angeblich nur selten den sich ausbreitenden Asiatischen Marienkäfer (Harmonia axyridis.
Um den handelt es sich aber hier offensichtlich.
(Meine Fotos habe ich erst nachträglich per Internet deuten können)
Beste Grüße
MBM
Es sollte sich hier um den Kokon der Marienkäfer-Brackwespe (Dinocampus coccinellae) handeln. Deren Larve spinnt zum Schluss den ausgezehrten Marienkäfer, der ja bekanntlich von größeren Fressfeinden aus Erfahrung gemieden wird, über sich als eigenes Schutzschild mit ein. Deshalb sieht es so aus, als ob Pilzhyphen die Käferbeine überwuchern.
Die auf europäische Marienkäfer spezialisierte Wespe befalle angeblich nur selten den sich ausbreitenden Asiatischen Marienkäfer (Harmonia axyridis.
Um den handelt es sich aber hier offensichtlich.
(Meine Fotos habe ich erst nachträglich per Internet deuten können)
Beste Grüße
MBM
- 4
-

MBM - Vereinsmitglied
- Beiträge: 155
- Registriert: Donnerstag 15. März 2018, 17:31
- Wohnort: Meißen
- Bewertung: 520
Re: Rätsel-Thread
Über diese Marienkäfer-Brackwespe ist weiteres Erstaunliches zu finden:
Der Käfer ist nicht wie von mir vermutet "ausgezehrt" (Darmbefall), sondern er wird von der Larve beim Verlassen des Käfers nur vorübergehend gelähmt - für den Zeitraum ihres zu beschützenden Kokons! 25 Prozent der reglosen Käfer sollen sich nach Schlüpfen der Wespen aus dem Kokon wieder vollständig von dieser Lähmung erholen.
Man kann nur staunen!
Beste Grüße
MBM
Der Käfer ist nicht wie von mir vermutet "ausgezehrt" (Darmbefall), sondern er wird von der Larve beim Verlassen des Käfers nur vorübergehend gelähmt - für den Zeitraum ihres zu beschützenden Kokons! 25 Prozent der reglosen Käfer sollen sich nach Schlüpfen der Wespen aus dem Kokon wieder vollständig von dieser Lähmung erholen.
Man kann nur staunen!
Beste Grüße
MBM
- 4
-

MBM - Vereinsmitglied
- Beiträge: 155
- Registriert: Donnerstag 15. März 2018, 17:31
- Wohnort: Meißen
- Bewertung: 520
Re: Rätsel-Thread
9 Tage nach dem Fund kann ich eine Fortsetzung liefern.
Das Blatt mit dem auffällig parasitierten Asiatischen Marienkäfer kam zur Beobachtung in eine Petrischale.
Obwohl der Käfer dieser Tage nochmal die Flügel geöffnet hatte, zeigt er jetzt keine Lebenszeichen mehr.
Aber nun ist die weibliche Marien-Käferbrackwespe (Dinocampus coccinellae) aus dem Kokon unter dem Käfer geschlüpft!
Im Garten ausgesetzt, wird sie weitere sich ausbreitende Harmonia axyridis - Exemplare finden. Wegen parthenogenetischer Fortpflanzung ist die nächste Generation nahezu gesichert.
Beste Grüße
MBM
Das Blatt mit dem auffällig parasitierten Asiatischen Marienkäfer kam zur Beobachtung in eine Petrischale.
Obwohl der Käfer dieser Tage nochmal die Flügel geöffnet hatte, zeigt er jetzt keine Lebenszeichen mehr.
Aber nun ist die weibliche Marien-Käferbrackwespe (Dinocampus coccinellae) aus dem Kokon unter dem Käfer geschlüpft!
Im Garten ausgesetzt, wird sie weitere sich ausbreitende Harmonia axyridis - Exemplare finden. Wegen parthenogenetischer Fortpflanzung ist die nächste Generation nahezu gesichert.
Beste Grüße
MBM
- 2
-

MBM - Vereinsmitglied
- Beiträge: 155
- Registriert: Donnerstag 15. März 2018, 17:31
- Wohnort: Meißen
- Bewertung: 520
Re: Rätsel-Thread
Was stimmt hier nicht?
Im GEO-Magazin 07/2021 wird dieses Bild gezeigt, auf S. 84.
Es ist in einem Artikel enthalten, „Salon der Weltensammler“, aus einer Serie von GEO-Expeditionsreporter Lars Abromeit, „Abromeits Expeditionen“, wobei es hier um den etwas elitären „Explorers Club“ in New York geht. Im Hauptquartier des Clubs sind Sammlungsstücke aus aller Welt ausgestellt, darunter diese merkwürdige Missbildung eines Elefanten mit vier Stoßzähnen.
Doch etwas auf der Seite stimmt nicht!
MfG,
Merkur
Im GEO-Magazin 07/2021 wird dieses Bild gezeigt, auf S. 84.
Es ist in einem Artikel enthalten, „Salon der Weltensammler“, aus einer Serie von GEO-Expeditionsreporter Lars Abromeit, „Abromeits Expeditionen“, wobei es hier um den etwas elitären „Explorers Club“ in New York geht. Im Hauptquartier des Clubs sind Sammlungsstücke aus aller Welt ausgestellt, darunter diese merkwürdige Missbildung eines Elefanten mit vier Stoßzähnen.
Doch etwas auf der Seite stimmt nicht!
MfG,
Merkur
- 3
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Rätsel-Thread
"Unterkiefer" kommt mir etwas komisch vor. Bei heutigen Elefanten sitzen die Stoßzähne im Oberkiefer.
Mit Stoßzähnen im Unterkiefer ist mir nur das Mastodon bekannt.
Mit Stoßzähnen im Unterkiefer ist mir nur das Mastodon bekannt.
- 2
-

Trailandstreet - Mitglied
- Beiträge: 1174
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 21:02
- Wohnort: Ho'mbua
- Bewertung: 1693
Re: Rätsel-Thread
Ich würde das Fragment auch eher für den Rest des Oberkiefers halten. Mir fallen zusätzlich die beiden Mahlzähne auf - die zeigen doch in die falsche Richtung!?!
Wenn Unterkiefer, dann gingen die Stoßzähne beim lebenden Tier senkrecht nach oben. Wenn Oberkiefer, dann gingen sie senkrecht nach unten - - - so, wie bei einem Walross. Das hat aber leider nicht die Mahlzähne bis vorne, sondern normale.
Bei keinem meiner Kandidaten hab ich jemals von vier Stoßzähnen gehört oder gelesen; auch bei anderen Säugetieren sind mir verdoppelte Eckzähne nicht bekannt.
Wenn Unterkiefer, dann gingen die Stoßzähne beim lebenden Tier senkrecht nach oben. Wenn Oberkiefer, dann gingen sie senkrecht nach unten - - - so, wie bei einem Walross. Das hat aber leider nicht die Mahlzähne bis vorne, sondern normale.
Bei keinem meiner Kandidaten hab ich jemals von vier Stoßzähnen gehört oder gelesen; auch bei anderen Säugetieren sind mir verdoppelte Eckzähne nicht bekannt.
- 2
- Bielefant
- Mitglied
- Beiträge: 41
- Registriert: Mittwoch 23. April 2014, 17:47
- Bewertung: 71
Re: Rätsel-Thread
Lösung:
Trailandstreet und Bielefant haben es gelöst: Die Stoßzähne sitzen natürlich im Oberkiefer, gleich rechts und links des Rüssels.
Hier sind zwei Bilder von Schädeln im Museum von Skukuza im Krüger-Nationalpark, Südafrika. Fotografiert im März 2003.
Eine Verdoppelung der Stoßzähne dürfte eine sehr seltene Missbildung sein.
MfG,
Merkur
Trailandstreet und Bielefant haben es gelöst: Die Stoßzähne sitzen natürlich im Oberkiefer, gleich rechts und links des Rüssels.
Hier sind zwei Bilder von Schädeln im Museum von Skukuza im Krüger-Nationalpark, Südafrika. Fotografiert im März 2003.

Eine Verdoppelung der Stoßzähne dürfte eine sehr seltene Missbildung sein.
MfG,
Merkur
- 3
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Rätsel-Thread
Was ist das?
Es sitzt an der Unterseite eines über den Teich hängenden Blattes vom Rohrkolben.
Blattbreite ca. 15 mm. Aufnahme 20. Juni 2021.
MfG,
Merkur
Es sitzt an der Unterseite eines über den Teich hängenden Blattes vom Rohrkolben.
Blattbreite ca. 15 mm. Aufnahme 20. Juni 2021.
MfG,
Merkur
- 3
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Rätsel-Thread
Auflösung:
Gelege ist zwar richtig, doch nicht die Art bzw. Gattung.
Es ist von einer Waffenfliege (Fam. Stratiomyidae). Die Larven leben im Wasser; gelegentlich sieht man große Larven (ca. 3 cm),
die mit den Atemöffnungen am Hinterende an der Wasseroberfläche "hängen" und sich merkwürdig schlängelnd bewegen. Sie leben im Schlamm..
Im Rätselbild sind rechts oben zwei frisch geschlüpfte Lärvchen zu sehen, hier (unten) durchs Mikroskop nochmals vergrößert:
Im Wasser war zu sehen, wie diese schon mit dem spitzen Hinterende und einem winzigen Haarkranz an der Oberfläche hingen.
MfG,
Merkur
Gelege ist zwar richtig, doch nicht die Art bzw. Gattung.
Es ist von einer Waffenfliege (Fam. Stratiomyidae). Die Larven leben im Wasser; gelegentlich sieht man große Larven (ca. 3 cm),
die mit den Atemöffnungen am Hinterende an der Wasseroberfläche "hängen" und sich merkwürdig schlängelnd bewegen. Sie leben im Schlamm..
Im Rätselbild sind rechts oben zwei frisch geschlüpfte Lärvchen zu sehen, hier (unten) durchs Mikroskop nochmals vergrößert:
Im Wasser war zu sehen, wie diese schon mit dem spitzen Hinterende und einem winzigen Haarkranz an der Oberfläche hingen.
MfG,
Merkur
- 5
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Rätsel-Thread
Das war ein schwieriges Rätsel von Merkur. Danke für die Auflösung.
Auf Waffenfliegen bin ich nicht gekommen, habe aber 2 solche Arten jeweils im Juli 2018 und 2019 in Gewässernähe fotografiert.
Hier also zur Rätselergänzung Bilder der möglichen Verursacher:
Der Furcht einflößende Sammelname dieser Fliegengruppe soll auf das an bunte Uniformen erinnernde Äußere zurückgehen.
Beste Grüße
MBM
Auf Waffenfliegen bin ich nicht gekommen, habe aber 2 solche Arten jeweils im Juli 2018 und 2019 in Gewässernähe fotografiert.
Hier also zur Rätselergänzung Bilder der möglichen Verursacher:
Der Furcht einflößende Sammelname dieser Fliegengruppe soll auf das an bunte Uniformen erinnernde Äußere zurückgehen.
Beste Grüße
MBM
- 4
-

MBM - Vereinsmitglied
- Beiträge: 155
- Registriert: Donnerstag 15. März 2018, 17:31
- Wohnort: Meißen
- Bewertung: 520
Re: Rätsel-Thread
Neues Rätsel
Angeregt durch das letzte Rätsel und das Bild von MBM habe ich am 2. 7. mal im Garten nach adulten Waffenfliegen Ausschau gehalten.
Entdeckt habe ich das:
MfG,
Merkur
Angeregt durch das letzte Rätsel und das Bild von MBM habe ich am 2. 7. mal im Garten nach adulten Waffenfliegen Ausschau gehalten.
Entdeckt habe ich das:
MfG,
Merkur
- 2
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Rätsel-Thread
Auflösung:
Anscheinend will sich niemand mehr dazu äußern. Steffen Kraus hat in der Bewertung "Wollbiene" vorgeschlagen; richtig!
Es ist Anthidium manicatum, die "Große Wollbiene" oder "Garten-Wollbiene".
Wahrscheinlich habe ich sie bereits länger im Garten. Im Verhalten erinnert sie ziemlich an Schwebfliegen, steht oft kurzzeitig vor Blüten in der Luft, um dann rasch abzuschwenken.
Die Tiere - es ist ein Männchen - attackieren gerne andere Bienen, fliegen sie an, und haben am Hinterende ein paar Zacken, mit denen sie die Konkurrenz vertreiben.
Boro hat kürzlich den Gamander (Teucrium schamaedrys) als für Bienen wichtige Gartenpflanze vorgestellt, hier. Auch „meine“ Wollbienen halten sich bevorzugt daran auf!
MfG,
Merkur
Anscheinend will sich niemand mehr dazu äußern. Steffen Kraus hat in der Bewertung "Wollbiene" vorgeschlagen; richtig!
Es ist Anthidium manicatum, die "Große Wollbiene" oder "Garten-Wollbiene".
Wahrscheinlich habe ich sie bereits länger im Garten. Im Verhalten erinnert sie ziemlich an Schwebfliegen, steht oft kurzzeitig vor Blüten in der Luft, um dann rasch abzuschwenken.
Die Tiere - es ist ein Männchen - attackieren gerne andere Bienen, fliegen sie an, und haben am Hinterende ein paar Zacken, mit denen sie die Konkurrenz vertreiben.
Boro hat kürzlich den Gamander (Teucrium schamaedrys) als für Bienen wichtige Gartenpflanze vorgestellt, hier. Auch „meine“ Wollbienen halten sich bevorzugt daran auf!

MfG,
Merkur
- 3
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Rätsel-Thread
Flügel und Habitus sprechen dafür, dass sich hier jemand in der Ordnung geirrt hat: Es handelt sich bei dem Tier auf dem Bild nämlich nicht um eine Biene (Ordnung Hymenoptera), sondern um einen Zweiflügler (Ordnung Diptera)! Die Fliege verwendet eine Form von Mimikry, was die Färbung erklärt.
Um das Tier genau zu bestimmen kenne ich mich in der Ordnung zu wenig aus, zumal es ohne Fundort ohnehin schwierig wird. Ich würde spontan zur Familie Syrphidae tendieren, welche auch die heimischen Mimikry-Schwebfliegen enthält, will mich aufgrund der nicht vollständig zu sehenden Flügel aber nicht festlegen.
Um das Tier genau zu bestimmen kenne ich mich in der Ordnung zu wenig aus, zumal es ohne Fundort ohnehin schwierig wird. Ich würde spontan zur Familie Syrphidae tendieren, welche auch die heimischen Mimikry-Schwebfliegen enthält, will mich aufgrund der nicht vollständig zu sehenden Flügel aber nicht festlegen.
- 4
- Benni
- Mitglied
- Beiträge: 25
- Registriert: Montag 8. Juni 2020, 18:21
- Wohnort: Ratingen
- Bewertung: 61
Re: Rätsel-Thread
Benni hat Recht, abgebildet ist eine Fliege.
Alex Wild hat über dem Bild geschrieben: "Save the bees! They're all turning into flies!"
(Rettet die Bienen! Sie verwandeln sich alle in Fliegen!).
Man kann auch an der Antenne (mit der borstenförmigen Arista) erkennen, dass es sich um eine Angehörige der Fliegen-Unterordnung Brachycera handelt, also eine kurzfühlerige Fliege. Mücken (U.O. Nematocera) haben fadenförmig lange, vielgliedrige Fühler (gelegentlich dicht mit Haaren besetzt).
MfG,
Merkur
Edit: (nach den ersten beiden Bewertungen!)
Man könnte auch noch über die Texte im Bild bzw. darunter fachsimpeln:
„Drohnen haben keinen Vater, sie haben nur eine Mutter und einen Großvater“ (im Bild).
„Der Drohn entsteht aus einem unbefruchteten Ei und erhält sein gesamtes Genom von seiner Mutter und seinem Großvater. Dies kennt man unter der Bezeichnung Parthenogenese.“ (unter dem Bild)
Richtig ist, dass die Drohnen ihr gesamtes Erbgut von der Mutter erhalten. Dabei wird dieses halbiert (zum haploiden Chromosomensatz). Doch stecken darin Chromosomen (-teile) sowohl vom Großvater als auch von der Großmutter, also von beiden Eltern der Mutter.
Und „Parthenogenese“ heißt ja Jungfernzeugung, d. h. dass ein weibliches Tier Nachkommen produziert, ohne begattet zu sein. Spezieller gefasst: Das (begattete) Muttertier legt neben befruchteten auch unbefruchtete Eier, mit eben nur einem Chromosomensatz. Bei den Hymenopteren kann daraus ein komplettes Tier entstehen, eben ein haploides Männchen. Fachbegriff: Arrhenotokie.
Doch das ist nicht alles:
Es gibt weitere Formen von Parthenogenese, z. B. bei bestimmten Inselrassen von Eidechsen: Eine Möglichkeit ist, dass bei der Eireifung eine der zwei Reifungsteilungen unterbleibt. So legt das Muttertier diploide Eier, die sich aber stets zu Weibchen entwickeln, da sie ja nur die weiblichen Geschlechtschromosomen enthalten. Dasselbe Ergebnis wird erzielt, wenn nach der zweiten Reifungsteilung (zu zwei haploiden Zellen) diese direkt wieder verschmelzen, so dass wiederum ein Ei mit den beiden Chromosomensätzen der Mutter entsteht. Fachbegriff: Thelytokie.
Komplizierter wird es bei Blattläusen, wo Weibchen sich thelytok fortpflanzen können (im Frühjahr wächst die Population damit sehr rasch, besteht nur aus Weibchen, die wiederum Weibchen gebären). Gegen Herbst entstehen parthenogenetisch Individuen („Sexuparae“), die parthenogenetisch sowohl Männchen als auch Weibchen produzieren. Fachbegriff: Amphitokie. Die wiederum verpaaren sich, und die Weibchen legen befruchtete Eier (gebären also keine lebenden Larven). Daraus schlüpfen nach der Überwinterung Larven, die sich alle zu lebendgebärenden Weibchen entwickeln.
Solche Fakten zu sehr vereinfacht darzustellen führt halt unausweichlich zu Fehlern.
Alex Wild hat über dem Bild geschrieben: "Save the bees! They're all turning into flies!"
(Rettet die Bienen! Sie verwandeln sich alle in Fliegen!).
Man kann auch an der Antenne (mit der borstenförmigen Arista) erkennen, dass es sich um eine Angehörige der Fliegen-Unterordnung Brachycera handelt, also eine kurzfühlerige Fliege. Mücken (U.O. Nematocera) haben fadenförmig lange, vielgliedrige Fühler (gelegentlich dicht mit Haaren besetzt).
MfG,
Merkur
Edit: (nach den ersten beiden Bewertungen!)
Man könnte auch noch über die Texte im Bild bzw. darunter fachsimpeln:
„Drohnen haben keinen Vater, sie haben nur eine Mutter und einen Großvater“ (im Bild).
„Der Drohn entsteht aus einem unbefruchteten Ei und erhält sein gesamtes Genom von seiner Mutter und seinem Großvater. Dies kennt man unter der Bezeichnung Parthenogenese.“ (unter dem Bild)
Richtig ist, dass die Drohnen ihr gesamtes Erbgut von der Mutter erhalten. Dabei wird dieses halbiert (zum haploiden Chromosomensatz). Doch stecken darin Chromosomen (-teile) sowohl vom Großvater als auch von der Großmutter, also von beiden Eltern der Mutter.
Und „Parthenogenese“ heißt ja Jungfernzeugung, d. h. dass ein weibliches Tier Nachkommen produziert, ohne begattet zu sein. Spezieller gefasst: Das (begattete) Muttertier legt neben befruchteten auch unbefruchtete Eier, mit eben nur einem Chromosomensatz. Bei den Hymenopteren kann daraus ein komplettes Tier entstehen, eben ein haploides Männchen. Fachbegriff: Arrhenotokie.
Doch das ist nicht alles:
Es gibt weitere Formen von Parthenogenese, z. B. bei bestimmten Inselrassen von Eidechsen: Eine Möglichkeit ist, dass bei der Eireifung eine der zwei Reifungsteilungen unterbleibt. So legt das Muttertier diploide Eier, die sich aber stets zu Weibchen entwickeln, da sie ja nur die weiblichen Geschlechtschromosomen enthalten. Dasselbe Ergebnis wird erzielt, wenn nach der zweiten Reifungsteilung (zu zwei haploiden Zellen) diese direkt wieder verschmelzen, so dass wiederum ein Ei mit den beiden Chromosomensätzen der Mutter entsteht. Fachbegriff: Thelytokie.
Komplizierter wird es bei Blattläusen, wo Weibchen sich thelytok fortpflanzen können (im Frühjahr wächst die Population damit sehr rasch, besteht nur aus Weibchen, die wiederum Weibchen gebären). Gegen Herbst entstehen parthenogenetisch Individuen („Sexuparae“), die parthenogenetisch sowohl Männchen als auch Weibchen produzieren. Fachbegriff: Amphitokie. Die wiederum verpaaren sich, und die Weibchen legen befruchtete Eier (gebären also keine lebenden Larven). Daraus schlüpfen nach der Überwinterung Larven, die sich alle zu lebendgebärenden Weibchen entwickeln.
Solche Fakten zu sehr vereinfacht darzustellen führt halt unausweichlich zu Fehlern.

- 4
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
Re: Rätsel-Thread
Was ist das?
Es befindet sich seit 25. Aug. auf einem Blatt in meinem Garten. Ausschnitt aus einer noch größeren Fläche.
MfG,Es befindet sich seit 25. Aug. auf einem Blatt in meinem Garten. Ausschnitt aus einer noch größeren Fläche.
Merkur
- 2
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3668
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9937
-

Trailandstreet - Mitglied
- Beiträge: 1174
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 21:02
- Wohnort: Ho'mbua
- Bewertung: 1693
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 92 Gäste
